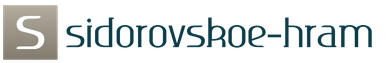„Ich bin“ ist ein nutzloser Gedanke;
„Das bin ich nicht“ ist ein nutzloser Gedanke;
„Ich werde“ ist ein nutzloser Gedanke;
„Das werde ich nicht“ ist ein nutzloser Gedanke.
Nutzlose Gedanken sind eine Krankheit, ein Geschwür, ein Dorn im Auge.
Aber alle nutzlosen Gedanken überwunden haben
nannte man den stillen Denker.
Und der Denker, der Stille, erhebt sich nicht mehr,
kommt nicht mehr zurück
Er kennt weder Angst noch Leidenschaft mehr.
MAJJHIMA-NIKAYA, 140
Fünfter Teil
FAKTOREN DES BEWUSSTSEINS (CETASIKA)
1. PRIMÄRE ODER STÄNDIG NEUTRALE FAKTOREN
Die 121 Bewusstseinsklassen stellen einen vollständigen Bezugsrahmen dar, der alle weiteren Details der buddhistischen Psychologie abdeckt und durch den alle Bewusstseinsphänomene definiert werden können. Diese Klassifizierung ist wie der Rahmen eines Gebäudes, in dem verschiedene Materialien entsprechend ihrer Beschaffenheit an ihrem Platz platziert werden müssen.
Das Hauptmaterial unserer mentalen Struktur sind 52 Bewusstseinsfaktoren ( cetasika). Sie sind hinsichtlich der Grundursachen unterteilt ( hetu) in drei Gruppen eingeteilt: günstige, ungünstige und neutrale Faktoren. Die ersten beiden Gruppen umfassen jene Eigenschaften des Geistes oder Charakters, die auf günstige oder ungünstige Grundursachen zurückzuführen sind. Die dritte Gruppe ist jedoch moralisch neutral und kann mit der einen oder anderen der oben genannten Gruppen kombiniert werden (aus diesem Grund wird sie Annasamana = „dieses oder jenes“ genannt), da ihre Faktoren je nach Kombination mit anderen günstige oder ungünstige Zustände erzeugen Faktoren. Und obwohl diese neutralen Bewusstseinsfaktoren ( cetasika) sind nicht in der Lage, die Richtung des menschlichen Geistes zu bestimmen, sie sind dennoch genauso wichtig wie andere Faktoren. Sie umfassen sogar jene Elemente, die eine unverzichtbare Bedingung des Bewusstseins darstellen und daher in jedem Geisteszustand vorkommen. Diese Elemente bilden eine Gruppe dauerhaft oder primäre Faktoren (sabba-citta-sadharana), während der Rest die Gruppe bildet sekundäre neutrale Faktoren (pakinnaka), die nicht immer im Bewusstsein vorhanden sind.
Die dauerhaften oder primären neutralen Faktoren sind die folgenden:
- Phassa mentaler Kontakt (oder Sinneseindruck);
- Vedana Gefühl (oder Emotion);
- Sanna Wahrnehmung, Wahrnehmung;
- Chetana Wille;
- ekaggata Unidirektionalität;
- jivitindriya geistige Vitalität;
- manasikara spontane Aufmerksamkeit.
Sofern diese Faktoren nicht mit anderen Faktoren kombiniert werden, wie zum Beispiel in den zehn reaktiven Klassen des Sinnesbewusstseins, das keine Grundursachen hat ( ahetuka-cittani 1-5 und 8-12), dann bleiben sie in einer Art embryonalem Zustand, während sie in Kombination mit anderen neutralen und moralischen Faktoren, wie zum Beispiel im Fall von dhyānischen Zuständen, wo Einseitigkeit ( ekaggata) steigt auf den höchsten Konzentrationsgrad ( Samadhi), sind sie in der Lage, alle ihre verborgenen Kräfte zu offenbaren.
Phassa Wesen des reinen („nackten“) Kontakts des Bewusstseins mit seinem Objekt, beispielsweise die erste Wahrnehmung eines Sinneseindrucks ohne Kenntnis seiner charakteristischen Merkmale, die dem dritten Faktor innewohnt Sanna. Sanna Dies ist das Wachprinzip der Erkenntnis, das Erkennen der Zugehörigkeit eines wahrgenommenen Sinnessignals zu einem bestimmten Sinnesfeld. Chetana Es handelt sich nicht um eine Reaktion auf eine bestimmte Wahrnehmung oder Unterscheidung, sondern um einen emotionalen Grundzustand, der mit dieser ersten Wahrnehmung einhergeht. Auf diese Weise, Chetana, als primärer Faktor, sollte nicht als Ausdruck des freien Willens betrachtet werden, sondern als instinktiver Wille, der durch vorhergehende Ursachen begrenzt wird ( hetu ist zu einem integralen Bestandteil des Charakters geworden) und hat daher keinen entscheidenden ethischen Wert. Zu den Hauptfaktoren ekaggata kann als einschränkend definiert werden, und manasikara als Leitprinzipien, wohingegen Chetana ist die motivierende, treibende Kraft, das leitende und aktive Prinzip hinter ihrer Manifestation. Ekaggata Es gibt eine Fähigkeit, die ein Objekt von einem anderen unterscheidet und verhindert, dass es sich auflöst und mit anderen Objekten verschmilzt. Ich rufe manasikara„spontane“ Aufmerksamkeit, weil dieser Faktor nicht durch den Willen auferlegt wird, sondern vielmehr durch die immanenten Eigenschaften des Objekts selbst erregt wird, die Aufmerksamkeit „erregen“ (oder einen Vorzustand dieser Fähigkeit). Ekaggata Und manasikara kann als positive und negative Seite derselben Funktion definiert werden: Die erste schließt alles aus (oder wendet sich von ihm ab), was nicht mit dem Objekt zusammenhängt; der zweite richtet sich auf den so isolierten Gegenstand. Jpvitindriya, psychische Energie oder Vitalität, ist das grundlegende und verbindende Prinzip der sechs anderen Faktoren und muss aus dieser Sicht entweder am Anfang oder am Ende der gegebenen Sequenz platziert werden. Es wurde jedoch nicht an den Anfang gestellt, wahrscheinlich weil es notwendig war, die Entwicklung der Sequenz als Ergebnis des Einflusses eines äußeren oder inneren Reizes darzustellen. Zimmer manasikara an letzter Stelle, nach jivitindriya, wird dadurch erklärt, dass manasikara ist eine Verbindung zwischen primären und sekundären neutralen Faktoren. Enge Verbindung zwischen Manasikara und Vitakka-Vichara Faktoren des diskursiven Denkens, die eine Reihe sekundärer Faktoren eröffnen, ist offensichtlich.
Wir sollten die angegebene Reihenfolge der einzelnen Faktoren in der obigen Aufzählung nicht als willkürlich oder zufällig verstehen: Hier können immer einer oder mehrere identifiziert werden Platzierungsprinzipien. In der Gruppe der primären und sekundären neutralen Faktoren gibt es neben der wesentlichen und logischen Interdependenz auch eine kausal-zeitliche Beziehung, eine „Eins-von-anders“- und „Eins-nach-der-andere“-Beziehung, gleichzeitig begleitet von eine Steigerung des Aktivitätsgrades. Andererseits lässt sich dieser Verlauf unter den primären Faktoren in zwei Untergruppen einteilen: rezeptiv-passiv und aktiv-beeinflussend, die wie folgt dargestellt werden können:
| - 3 Phasen - 3 Vedana - 1 Sanna | + 1 Chetana + 2 Ekaggats + 3 Manasikars |
| jivitindriya | |
Wir haben oben bereits die drei Aspekte der geistigen Erregung erwähnt ( Vedana): positiv, negativ und neutral, je nachdem, ob es als angenehm akzeptiert, als unangenehm abgelehnt oder als gleichgültig akzeptiert wird. Betrifft diese Einteilung nur Sinneseindrücke, so heißt sie Anubhavana oder Einteilung nach körperlicher Empfindlichkeit; Wenn diese Einteilung mit seelischen Gefühlen, Emotionen oder seelischen Reaktionen verbunden ist, zum Beispiel Freude und Trauer, dann spricht man von „ indriya-yabheda, d.h. Einteilung nach regulativen Kräften oder Leitprinzipien, da Freude und Leid (bzw. Trauer) einen entscheidenden ethischen Einfluss haben.
In dieser Abteilung upekkha bedeutet das Fehlen von Emotionen sowohl von Freude als auch von Trauer, d. h. geistige Gleichgültigkeit, oder besser: „ein Gefühl von weder Freude noch Trauer“.
Freude ( somanassa) und Trauer ( domanassa) unterscheiden sich von den körperlichen Gefühlen von Gesundheit und Krankheit, körperlichem Vergnügen (Genuss) und Schmerz durch ihre Fähigkeit, „das Herz zu berühren“ und unseren Geist „zu erregen, zu stören“.
Wo wir uns treffen sukha Und dukkha neben an somanassa Und domanassa Man könnte sagen, dass sich der Charakter der ersten Begriffe auf die körperlichen Sinne bezieht, wie wir bereits im Fall von gesehen haben ahetuka-cittani, während adukkhamasukha„ein Gefühl von weder Freude noch Trauer“ entsteht durch Sinneseindrücke. Eine Ausnahme stellt hier jedoch der Körperkontakt dar: Er löst eine hedonisch positive oder negative Reaktion aus, d. h. schafft niemals einen Zustand hedonischer Gleichgültigkeit. Shwe Zan Aung (Compendium of Philosophy, S. 233) erklärt es wie folgt:
Wir sprechen in unserer Alltagssprache von mäßiger Hitze als einem Zwischenzustand zwischen heiß und kalt, aber in der wissenschaftlichen Sprache lassen wir dies niemals zu. Streng logisch gesehen gibt es im Akt der Berührung keinen Platz für geistige Gleichgültigkeit ( upekkha). Upekkha ist nach unserer Klassifizierung ein rein mentales Gefühl Vedana und daher subjektiv. Objektive Lust und Schmerz können je nach Ausmaß der körperlichen Einwirkung mental als gleichgültig eingeschätzt werden. ( Vedana deckt nur den hedonischen Aspekt eines Gefühls oder einer Emotion ab.) Ich klassifiziere die verschiedenen Aspekte von Vedan wie folgt:
| Anubhavana | Vedana | Indriyabheda |
| 1) dukkha | Kayika cetasika | 1) dukkha 2) domanassa |
| 2) adukkam-asukha | cetasika | 3) upekkha |
| 3) Sucha | Kayika cetasika | 4) Sucha 5) Somanassa |
Also der Wert dukkha Und sukha hängt von der entsprechenden (relativen) Einordnung bzw. dem Kontext ab, in dem diese Ausdrücke vorkommen, und kann neben der rein hedonischen Bedeutung, die aus psychologischer Sicht im Vordergrund steht, auch in ethischer Hinsicht verwendet werden Sinn als Glück oder Leid. Dies bedeutet jedoch nicht, dass sich hedonische und ethische Bedeutungen gegenseitig ausschließen, sondern dass die hedonischen und ethischen Aspekte sowohl sensorische als auch mentale Gefühle umfassen (wobei letztere wiederum im ethischen Sinne verstanden werden können).
Und schließlich müssen wir den spirituellen Aspekt erwähnen upekkha, nämlich tetramajjhattata, ein vollkommenes Gleichgewicht des Geistes, ein vollkommener spiritueller Gleichmut und Harmonie, die in der Erfahrung der höchsten spirituellen Objekte oder Bewusstseinszustände zum Vorschein kommen und daher vom negativen Zustand rein hedonischer Gleichgültigkeit unterschieden werden müssen (beide sind tatsächlich in der Lage, sich zu manifestieren). in der gleichen Bewusstseinsklasse). Siehe Abb. 10.
| Reaktion | Körperlich | Geistig | Spirituell |
|---|---|---|---|
| Positiv | Körperliches Wohlbefinden Gesundheit, Vergnügen (kayika sukha) | Geistige Zufriedenheit (cetasika sukha) | Freude, Freude, spirituelle Glückseligkeit (sukha) |
| Zufriedenheit + Aufregung = Freude (somanassa) |
|||
| Negativ | Körperliches Leiden, Schmerz (kayika dukkha) | Geistiges Leiden (cetasika dukkha) | Spirituelles Leiden (dukkha) |
| seelisches Leiden + Aufregung = Trauer (domanassa) |
|||
| Neutral | weder schmerzhaft, weder ein angenehmes Gefühl (adukkhamasukha) | Geistige Gleichgültigkeit (upekkha) | Spiritueller Frieden Gleichmut (upekkha im höchsten Sinne) (tatramajjhattata) |
| Manchmal ethisch hedonistisch | Ethisch ahedonisch | ||
Reis. 10. Klassifizierung von Gefühlen
Es ist die falsche Interpretation des Wortes „upekkha“ hat zu den größten Missverständnissen bei der Beurteilung der buddhistischen spirituellen Position geführt. Die nicht näher bezeichnete, rein negative Übersetzung dieses überaus wichtigen Konzepts durch das Wort „Gleichgültigkeit“ löste bei Nicht-Buddhisten den oft wiederholten Vorwurf aus, dass sie lieben ( metta), Mitgefühl ( Karuna) und Mitfreude ( Mudita), die zusammen mit upekkha die vier „göttlichen Zustände“ genannt ( brahmavihara), sind nur Hilfsschritte zur Erlangung völliger Gleichgültigkeit, die angeblich das Ziel und der höchste Punkt der buddhistischen Befreiungslehre ist. Basierend auf der Tatsache, dass upekkha Am Ende dieser Reihe kamen sie zu dem Schluss, dass Liebe und Mitgefühl für einen Buddhisten nur Mittel zur eigenen Erlösung sind und dass der Buddhismus daher im Gegensatz zum Christentum keinen wahren Altruismus aufweist und diesem in seinem ethischen Wert unterlegen ist.
Doch in Wirklichkeit ist die Situation völlig anders: So wie Mitgefühl und Mitfreude der Nächstenliebe, die sich gerade in diesen beiden Eigenschaften manifestiert, keinen Abbruch tun, so ist es auch so upekkha beseitigt bisherige Eigenschaften nicht. Nur ein Mensch, der sich von der Macht der Dinge befreit hat, der seinen eigenen Freuden und Sorgen gegenüber gleichgültig geworden ist, nur er ist in der Lage, gleichberechtigt am Leben aller Wesen teilzunehmen, ohne darüber nachzudenken, ob andere auf ihn reagieren werden Gegenseitigkeit oder Feindseligkeit. Nur Verfügbarkeit upekkha, das perfekt ( Samma) spirituelles und mentales Gleichgewicht, gibt Metta, Karuna Und Mudita ihre umfassende Grundlage und befreit diese Eigenschaften aus dem engen Rahmen persönlicher Bindung. Man kann argumentieren, dass Liebe, Mitgefühl und Mitfreude nicht nur in zu finden sind upekkha seine Vollendung, sondern darüber hinaus nämlich upekkha ist eine Voraussetzung für diese Eigenschaften, die es dem Vollkommenen ermöglichen, wie die Sonne, sowohl den Gerechten als auch den Ungerechten gleichermaßen Licht zu bringen.
Upekkha Im höchsten Sinne gibt es das heilige, unerschütterliche Gleichgewicht der Seele, dem sowohl Gleichgültigkeit als auch Apathie fremd sind und für das es nicht den geringsten Unterschied zwischen dem eigenen Selbst und dem Selbst eines anderen gibt, von dem Shantideva in der ersten Karika spricht „Sikschasamucchaya“ auf die folgende Weise:
„Wenn ich und mein Nachbar Angst und Leid gleichermaßen hassen, wo bleibt dann meine Überlegenheit, Schutz für mich selbst zu suchen und nicht für einen anderen?“
2. SEKUNDÄRE NEUTRALE FAKTOREN
Sekundäre neutrale Faktoren sind:
- Vitakka(diskursives) Denken im Anfangsstadium;
- Vichara Reflexion oder unterstützendes Denken (Fortsetzung des diskursiven Denkens);
- Adhimokkha Entschlossenheit (das Ergebnis diskursiven Denkens);
- Viriya Willenskraft, Energie, Anstrengung;
- Piti Interesse, Vergnügen, Freude, Freude (je nach Intensitätsgrad der Manifestation);
- Chanda Wunsch zum Handeln, Wunsch nach Erfüllung, Wille zur Erfüllung.
Mit drei dieser Faktoren sind wir bereits in unserer Analyse der Stufen der Vertiefung in das Bewusstsein der reinen Form vertraut geworden ( rupa-jhana), auf dem sie sukzessive eliminiert wurden Vitakka, Vichara Und Piti. Ein sehr wichtiger Indikator für die positive Natur der Dhyan-Vertiefung ist, dass die aktivsten Faktoren dieser Gruppe, nämlich adhimokkha, viriya Und Chanda werden insgesamt gespeichert jhanah wie im Reich der Reinen Form ( Rupadhatu) und im Bereich Non-Form ( Arupadhatu). Der logische Zusammenhang zwischen den Faktoren dieser Gruppe, vom ersten Denkimpuls bis zum „Streben nach Taten“, ist in seiner ganzen Kontinuität offensichtlich. Es ist kaum der Rede wert, dass, wenn der erste Impuls ( Vitakka) nicht stark genug ist oder Zweifel und Zögern im Stadium des reflexiven Denkens noch nicht überwunden sind ( Vichara), dann Entschlossenheit Adhimokkha, was wörtlich „Befreiung“ bedeutet, nämlich Befreiung von Zweifel oder Unsicherheit ( adhi + viel; munichagi = Freigabe) kann nicht erreicht werden und der Prozess wird vorzeitig beendet. Auf diese Weise, Adhimokkha es gibt eine Energiequelle ( Viriya), die Freisetzung zuvor verborgener Macht durch Beseitigung von Hindernissen für ihre Manifestation. Diese Energie, multipliziert mit Interesse oder Inspiration ( Piti), und letzteres kann bis zur höchsten Stufe der Glückseligkeit ansteigen ( Sikh), führt zum Willen zur Umsetzung ( Chanda).
Chhanda, so Shwe Zan Aung, wurde von Kommentatoren als erklärt „kattukamayata“ oder„Wunsch zum Handeln“ Je nach Wissensstand bzw. Einsichtsstand, Chanda verwandelt sich in beides kamachhanda(Synonym Tanha), d.h. sinnliche Lust, Leidenschaft oder in dhammachhanda, oder Wunsch, oder besser gesagt, Wunsch nach Befreiung. Auf sensorischer Ebene Chanda manifestiert sich überwiegend in Handlungen, auf spiritueller Ebene, zum Beispiel in der Meditation, wenn es nicht mehr notwendig ist, über Handlungen (im üblichen Sinne) zu sprechen, manifestiert es sich in einer fortschreitenden Bewegung hin zu einem Ziel. In beiden Fällen ist es der Wille, die Ergebnisse unserer geistigen Aktivität zu verwirklichen. Vielfältige Natur ist dem, was im europäischen Wortschatz mit den Ausdrücken „starkes Verlangen“, „Leidenschaft“, „Lust“ bezeichnet wird, sehr ähnlich, obwohl diese Begriffe in den Übersetzungen der buddhistischen Literatur ihren neutralen Charakter (im moralischen Sinne) verlieren und direkt werden Äquivalent „Tanha“. Die folgende schöne Passage aus George Sands „Lélias“ verdeutlicht zusammen mit dem Kommentar von Frau Rhys-David die Ähnlichkeit zwischen Chanda und „Leidenschaft“ in ihrem weiteren und primitiveren Sinne:
„Prometheus, Prometheus! Wolltest du den Menschen von den Fesseln des Schicksals befreien? ... Die Menschen gaben dir tausend symbolische Namen: Mut, Verzweiflung, Delirium, Rebellion, Verdammnis Nenne dich Verlangen! Du wurdest seit zehntausend Jahren nicht gefunden. Seit zehntausend Jahren antwortet mir die Unendlichkeit: Verlangen, Verlangen!
„Wir können es uns jetzt nicht erlauben, unsere ethischen (und ästhetischen) Vorstellungen zu verarmen, indem wir die Bedeutung dieses Begriffs verschwenderisch bis hin zu Tanha herabsetzen und dadurch, bildlich gesprochen, alle leidenschaftlichen Wünsche, einschließlich …, dem Teufel übergeben dhammachhanda, was Prometheus dazu ermutigte, Zeus herauszufordern, der Buddha vom Haus zum Bodhi-Baum führte, der Christus verpflichtete, den Himmel auf die Erde zu bringen. In dieser Hinsicht haben die Übersetzer großen Schaden angerichtet, indem sie das Wort „Verlangen“ abgewertet und damit die oberflächliche Kritik gerechtfertigt haben, die immer wieder von der buddhistischen Ethik als „Verneinung“ oder „Auslöschung aller Wünsche“ spricht. (Kompendium der Philosophie, S. 244 ff.)
3. Moralische Entscheidungsfaktoren und ihre Beziehungen
Ungünstige Bewusstseinsfaktoren bilden fünf Gruppen. Jede der ersten drei Gruppen zeichnet sich durch eine Grundidee aus, die die in der Gruppe aufgeführten Faktoren bestimmt. Diese zentralen Ideen sind drei ungünstige Grundursachen: Moha, Lobha, Dosa.
Ignoranz ( moha) geht mit Schamlosigkeit einher ( ahirika), Schamlosigkeit ( anottappa; Skrupellosigkeit, Unverschämtheit) und Angst ( uddhachca). Diese vier Faktoren sind in allen Klassen ungünstigen Bewusstseins vorhanden ( Sabbakusala-Sadharana). Ein unwissender Mensch kennt keine Scham, weil er sich die ganze Unwürdigkeit und Gemeinheit seiner Gedanken und Taten nicht vorstellen kann; er geht skrupellos mit seinen Mitteln um, weil er die Konsequenzen seines Handelns nicht erkennen kann. Die unbewusste Unsicherheit und das Ungleichgewicht, die aus diesem Geisteszustand resultieren, führen zu Unruhe und Ablenkung.
Durst ( Lobha) beeinträchtigt ein unparteiisches Urteil und führt zu falschen Ansichten ( ditthi) und Einbildung (lac; Stolz); Letzteres ist umso gefährlicher, als es mit einem gewissen Maß an Wissen verbunden ist, das, basierend auf Lobha, die auf die Selbstvergrößerung des Einzelnen abzielt.
Hass ( dosa) begleitet von Neid ( issa; Geiz), Egoismus ( machchhariya) und Angst, Angst ( kukkuchcha).
Vierte Gruppe Faulheit ( TCPNA) und Lethargie ( Middha) ist nicht auf eine bestimmte Grundursache zurückzuführen ( hetu). Sie stellen die negative Seite des Willens dar und können daher nur in den Bewusstseinsklassen vorhanden sein, die als „willensorientiert“ bezeichnet werden.
Zweifel, Skepsis ( vichikicchha) gehört seiner inneren Natur nach zur ersten Gruppe, unterscheidet sich jedoch von ihren Faktoren dadurch, dass es nicht in allen Klassen ungünstigen Bewusstseins vorkommt, sondern nur in einer von ihnen. Deshalb vichikicchha getrennt klassifiziert.
Günstige Bewusstseinsfaktoren werden wie folgt unterteilt:
- Diejenigen, die in allen Klassen mit günstigem Bewusstsein anwesend sind ( Sobhana Sadharana):
Saddha Glaube, Zuversicht;
sati Aufmerksamkeit; Aufmerksamkeit als Prozess; das Objekt „halten“ (Meditation); lit.: Erinnerung;
hiri Scham (als Stimme des Gewissens), Gewissenhaftigkeit, Selbstachtung (als Grundlage wahrer Ethik);
ottappa Gründlichkeit, Taktgefühl, Unterscheidungsvermögen in den Mitteln;
alobha Mangel an Durst, Gier; Selbstdistanz; Unparteilichkeit;
adosa Abwesenheit von Hass; Sympathie;
tatramajjhattata Ausgeglichenheit, Ruhe, Gleichmut;
kayapassaddhi Gleichmut der mentalen Elemente;
chittapassaddhi Gleichmut des Bewusstseins;
Kayalahuta Leichtigkeit, Beweglichkeit geistiger Elemente;
cittalahuta Leichtigkeit, Beweglichkeit des Bewusstseins;
Kayamuduta Elastizität, Reaktionsfähigkeit, Aufnahmefähigkeit mentaler Elemente;
cittamuduta Elastizität, Reaktionsfähigkeit, Aufnahmefähigkeit, Bewusstsein;
Kayakammannata Anpassungsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit mentaler Elemente;
chittakammannata Anpassungsfähigkeit, Bewusstseinsbereitschaft;
Kayapagunnata Erfahrung, Fähigkeit mentaler Elemente;
chittapagunnata Erfahrung, Geschicklichkeit des Bewusstseins;
kayujjukata Direktheit, Richtigkeit mentaler Elemente;
chittujjukata Direktheit, Korrektheit des Bewusstseins. - Drei „Abstinenzen“ ( viratiyo; „Moderation“): richtige Rede, richtiges Handeln, richtiger Lebensstil.
- Zwei „grenzenlose Zustände“ oder „Unendlichkeit“ ( appamannayo): Mitgefühl ( Karuna) und mitfühlende Freude ( Mudita; Co-Joy), also die Fähigkeit, die Freude und das Leid anderer Lebewesen zu teilen.
- Pannindriya Argumentation, die Fähigkeit, Dharmas zu erkennen, das Leitprinzip unseres Geistes.
Die ersten neunzehn dieser Faktoren, d. h. diejenigen, die allen Klassen günstigen Bewusstseins gemeinsam sind, stellen die Gegensätze der ungünstigen Faktoren dar und sind daher, soweit möglich, parallel angeordnet. Vollständige Parallelität ist nur zwischen mathematischen Größen denkbar, nicht jedoch zwischen psychologischen Begriffen. Ein Faktor in einer Kategorie kann zwei oder drei Faktoren in einer anderen Kategorie entsprechen.
So zum Beispiel Glaube ( Saddha) ist nicht nur gegen Zweifel, Skepsis ( vichikicchha), aber auch Missverständnis, Unwissenheit ( moha), Weil Saddha Im buddhistischen Verständnis handelt es sich dabei nicht um blinden Glauben, sondern um eine besondere Haltung des inneren Vertrauens und der Überzeugung. Gleichgewicht des Geistes ( tatramajjhattata), Gleichmut der mentalen Elemente und des Bewusstseins als Ganzes ( kaya-, citta-passaddhi) sind gleichermaßen gegen geistige Unruhe ( uddhachca), Angst (Angst) und Zweifel ( kukkuchcha + vicikicchha). Leichtigkeit ( lahuta), Empfänglichkeit ( Muduta), Anpassungsfähigkeit ( kammannata) und Geschick ( pagunnate) Geistige Elemente und Bewusstsein stehen im Gegensatz zu Faulheit und Lethargie ( thpna-middha). Die Beziehungen zwischen anderen Faktoren sind klar.
Sati beseitigt Täuschungen ( moha), Scham ( hiri) beseitigt Schamlosigkeit ( archirika), Takt ( ottappa) beseitigt Schamlosigkeit ( anottappa), Selbstablösung ( alobha) beseitigt den Durst ( Lobha), Sympathie ( adosa) beseitigt Hass ( dosa). Direktheit ( ujjukata) mentale Elemente ( Kaya) und Bewusstsein ( Chitta) sind gegen Zweifel und Skepsis. Der Begriff Kaya V bedeutet in diesem Fall natürlich nicht „Körper“, sondern bezieht sich auf namakaya Gruppe mentaler Elemente im Gegensatz zu Rupakaya-Körperkomponenten. Da letztere hier nicht berücksichtigt werden, sind die Begriffe Kaya Und Chitta drücken den Unterschied zwischen mentalen Elementen oder Bewusstseinsfaktoren und dem Bewusstsein als solchem aus: oder dem tatsächlichen Bewusstsein im Gegensatz zu seinen potentiellen Elementen.
Drei Enthaltsamkeiten, zwei grenzenlose Zustände und Vernunft ( pannindriya) sind allgemeinere Eigenschaften. Sie richten sich nicht gegen einen einzelnen ungünstigen Faktor, sondern gegen das ungünstige Bewusstsein als Ganzes. Es mag seltsam erscheinen, dass „richtiges Sprechen, richtiges Handeln und richtiges Leben“ zu den Faktoren des Bewusstseins zählen. Die Tatsache, dass dies geschehen ist, weist jedoch darauf hin, dass diese Begriffe nicht im gewöhnlichen (äußeren) Sinne verstanden werden sollten, sondern vielmehr als mentale Einstellungen oder solche mentalen Voraussetzungen, auf deren Grundlage richtiges Sprechen, richtiges Handeln und richtiges Leben entstehen.
In der nächsten Gruppe von vier „Unendlichkeiten“, d.h. solche Faktoren, die die Barrieren des Egoismus und begrenzter Objekte überwinden: metta(Mitgefühl, Liebe) Karuna(Mitgefühl), Mudita(Mitfreude) und upekkha(Gleichheit) sind nur vorhanden Karuna Und Mudita. Der Grund dafür liegt im buddhistischen Verständnis adosa ist nicht eine einfache Negation des Hasses, sondern sein direktes Gegenteil und somit metta bereits in der ersten Gruppe werden günstige Faktoren als bezeichnet adosa, während das Gleichgewicht ( upekkha) ist in derselben Gruppe vertreten wie tatramajjhattata.
Bemerkenswert ist, dass „Abstinenz“ und „Unendlichkeit“ die Faktoren sind, die die Gruppen der sogenannten „Erhabenen“ unterscheiden ( Mahaggata) Bewusstsein für Zustände der Vertiefung ( jhana) von überweltlich ( lokuttara-citta) Bewusstsein. Rupa Und Apyna – erkennen, wie Vermittler zwischen weltlichen und überweltlichen Zuständen sind in gewissem Sinne eine neutrale Art von Bewusstsein: Sie setzen zwar das Fehlen der vierzehn ungünstigen Faktoren voraus, sind aber nicht auf ein bestimmtes Ziel ausgerichtet. Allerdings ist „Abstinenz“ ( viratiyo) bedeutet bereits eine positive Einstellung, die nicht nur darin besteht, alles zu vermeiden, was als ungünstig verstanden wird ( akusala), aber auch fest darauf ausgerichtet, den Zustand eines Buddhas oder Arhats zu erreichen. Dies ist das grundlegende Motiv des überweltlichen Bewusstseins, und dementsprechend finden wir in allen seinen Klassen Abstinenz ( viratiyo).
Mitgefühl nimmt einen völlig entgegengesetzten Platz ein ( Karuna) und Mitfreude ( Mudita). Obwohl diese beiden Faktoren in den ersten vier Klassen des Bewusstseins der reinen Form vorkommen, sind sie im Überweltlichen nicht vorhanden jhanah, für Mitgefühl und Mitfreude sind immer noch auf weltliche Objekte gerichtet, während das überweltliche Bewusstsein ausschließlich auf das höchste Ziel ausgerichtet ist nibbana. Genau deshalb der fünfte jhana, und damit vier apyna-jhanas, die frei von jeglichen emotionalen und konkreten Objekten sind, können nicht mit ihnen in Verbindung gebracht werden Karuna Und Mudita.
Die letzten 52 Faktoren des günstigen Bewusstseins sind pannindriya, was wir mit „Argumentation“ übersetzt haben. Sie erscheinen in alle Sie sind in vier Bewusstseinsbereiche unterteilt und passen sich daher selbst an eine bestimmte Bewusstseinsebene an, die der Klasse entspricht, der sie zugeordnet sind. Wie Chanda, was sich je nach den Umständen entweder als manifestiert kamachhanda, oder wie dhammachhanda, panna kann Verständnis, genaue Wahrnehmung, Wissen (in einem begrenzten Sinne) oder tiefe Einsicht, Weisheit, Erleuchtung sein. Im sinnlich-weltlichen Bewusstsein kann es beispielsweise damit verbunden sein, die Konsequenzen unmittelbarer Handlungen zu verstehen und sie als günstig zu erkennen ( bisschen) und ungünstig ( akusala), während im überweltlichen Bewusstsein Panna ist mit dem Wissen um die höchsten Ziele verbunden, nämlich mit jenem Wissen, das zugleich Befreiung und Verwirklichung bedeutet. Auf diese Weise, pannindriya ist das Prinzip, durch das geistige und spirituelle Entwicklung möglich wird jivitindriya stellt das Prinzip dar, durch das sich unsere Lebenskräfte offenbaren: Beides sind regulierende Prinzipien ( indriya) die wichtigsten Energien.
Bevor wir unsere Betrachtung der 52 Bewusstseinsfaktoren abschließen, müssen wir den Zusammenhang sekundärer Faktoren identifizieren ( pakinnaka) mit Vertiefung des Bewusstseins der Meditation. Die Hauptfaktoren der ersten Stufe der Vertiefung sind, wie wir bereits gesehen haben Vitakka, Vichara, Piti, Sukha Und ekaggata. Außer sukha Und ekaggata die restlichen drei gehören zur Gruppe der sekundären neutralen Faktoren. Ekaggata Diese Faktoren haben wir bei der Analyse der Primärgruppe berücksichtigt.
Vitakka-vichara Wir nannten die charakteristischen Merkmale des diskursiven Denkens. Das ist der Unterschied zwischen vitakka-vicara Und manasikara und auch der Grund dafür vitakka-vicara werden als sekundäre Faktoren klassifiziert und manasikara zu den primären, obwohl „Aufmerksamkeit“ ohne einen vorherigen „Impuls“ undenkbar ist: vitakka-vicara bezeichnen abwechselnd entstehende und verschwindende Elemente des Denkens (jedoch keine direkten Sinneseindrücke) und gehören somit zu einer begrenzten, spezialisierten Kategorie des Bewusstseins, wohingegen manasikara, das in allen Bewusstseinsklassen vorhanden ist, ist das primäre Element.
Petey Und sukha werden als Vorfreude und deren Höhepunkt bezeichnet. Das erste ist die freudige Spannung des Wartens auf die Erfüllung eines Wunsches, d.h. genau das, was die treibende Kraft des Interesses und jeglicher Inspiration ist. Dies ist ein dynamisches Element jeder geistigen Aktivität und vor allem der Meditation. Es kann sich bis zur Ekstase entwickeln ( Ubbega Piti) oder Bewunderung ( Pharana Piti). Allerdings wäre nichts weniger zutreffend, als buddhistische Meditation „Ekstase“ zu nennen Piti, bevor es in dieses emotionale Extrem übergeht, geht es in einen Zustand spiritueller Glückseligkeit über, der völlig ruhig ist ( sukha). Deshalb ppti nur in den ersten drei Stufen der Vertiefung vorhanden. Ekstase ist das direkte Gegenteil des Zustands der Vertiefung, denn „Ekstase“ bedeutet wörtlich „außerhalb des Friedens“, Vertiefung bedeutet jedoch „innerer Frieden“, „Frieden in sich selbst“. Dem steht nicht entgegen, dass beide Staaten die gleichen Folgen haben können. Ein Mensch beseitigt die äußeren Grenzen seines „Ichs“, d.h. emotional sind die anderen inneren Grenzen, d.h. spiritueller Weg.
Ein Zustand des Höhepunkts, voller Vergnügen und Ruhe, erfüllt von innerer Glückseligkeit, sukha geht dann hinein höchste Form upekkha, was in der stereotypen Formel kanonischer Texte bestätigt wird: „upekkhako satima sukha viharati“„Wer unvoreingenommen nachdenkt, bleibt in Glückseligkeit.“
Die angegebenen fünf Bewusstseinsfaktoren, die in der ersten Stufe der Vertiefung vorhanden sind, gleichen ungünstige Eigenschaften aus ( nivaranani, Hindernisse), die in jedem Stadium der Vertiefung im Bewusstsein vorhanden sind. Durch die Aktivierung des Denkens ( Vitakka) Faulheit wird beseitigt ( Tahini) und Lethargie ( Middha), durch Reflexion ( Vichara) Zweifel und dementsprechend Skepsis ( vichikicchha), durch freudige Empfindungen ( Piti) Hass ist ausgelöscht ( byyapada, dosa), durch spirituelle Freude und Glückseligkeit ( sukha) Angst und Furcht werden zerstört ( uddhachca-kukkuccia) und schließlich durch upekkha Der Durst wird in einem Zustand der Vertiefung beseitigt ( Lobha) (was durch die Stärkung der Einspitzigkeit des Bewusstseins erreicht wird, ekaggata; siehe linke Tabellenhälfte Abb. elf).
Es ist Freude, die die Entstehung von Hass verhindert: Die Bedeutung dieser Wahrheit wurde leider noch nicht ausreichend gewürdigt. Freude könnte in viel größerem Maße zum Wohl der Menschheit beitragen als das Predigen strenger Moral, verschiedener Verbote und Einschüchterungsmethoden.
Es ist jedoch zu beachten, dass von den drei wichtigsten ungünstigen Faktoren nur zwei – Hass und Durst – in der ersten Stufe der Vertiefung ausgeglichen werden. Unwissenheit und dementsprechend Täuschung ( moha) wird nur in seiner manifestierten Form zerstört ( uddhachca). Dies weist darauf hin, dass vertieftes Bewusstsein nicht mit Wissen und dementsprechend mit vollkommener Durchdringung der Wahrheit verbunden sein muss ( samma ditthi). Aufgrund der falschen Anwendung der Konzentrationspraxis sowie aufgrund falscher, fehlerhafter mentaler Prämissen kann die Vertiefung zu einem Zustand des Leidens führen (wie aus dem siebten Kapitel des Abhidhammatha-Sangaha hervorgeht, wo domanassa neben aufgeführt sukha Und upekkha(einer der sieben Faktoren, die sich im dhyānischen Bewusstsein manifestieren). Der Faktor, der vor allem der Täuschung entgegenwirkt ( moha), ist Glaube ( Saddha) kombiniert mit einem gesammelten Geist ( sati), durch die bisher nur emotional oder intellektuell begründete Positionen zu unmittelbaren Erlebnissen, völliger visueller Gewissheit werden. Tisch ( FEIGE. elf) zeigt die 52 Bewusstseinsfaktoren in ihrer logischen Abfolge und in ihren Beziehungen. Faktoren, die ihrer Natur nach gegensätzlich sind und sich normalerweise gegenseitig ausschließen, werden durch gerade Linien verbunden. Die linke Hälfte der Tabelle zeigt, wie charakteristisch für das erste ist jhānas Faktoren schließen die „fünf Hindernisse“ aus, die (als sieben Faktoren) in der ungünstigen Gruppe aufgeführt sind cetasika. Die rechte Hälfte zeigt die Parallelität zwischen ungünstigen ( akusala) Faktoren und ihre Gegenfaktoren, die allen Klassen günstigen oder „schönen“ Bewusstseins gemeinsam sind ( sobhana-sadharana). Anhand dieser Tabelle können wir nicht nur sehen, wie ein Faktor einen anderen eliminiert, sondern auch, wie durch die Eliminierung eines Faktors ein anderer Faktor (oder einige davon) an seiner Stelle entstehen kann. Zum Beispiel denken ( Vitakka) beseitigt Faulheit und Lethargie ( Thina-middha) und macht so den Platz frei für die Leichtigkeit der mentalen Elemente und des Bewusstseins ( kaya-, chitta-lahuta, kaya-, chitta-muduta, kaya-, chitta-kammannata Und kaya-, citta-pagunnata); oder, in einem einfacheren Fall; Freude ( Piti) überwindet Hass ( dosa) und schafft stattdessen eine mitfühlende Gemütsverfassung ( adosa), usw.
Die Zahlen zeigen die traditionell akzeptierte Reihenfolge. Die letzten sechs Faktoren in der Spalte Sadharana(41 46) sollte zweimal gelesen werden, da jeder dieser Begriffe mit kombiniert wird Kaya Und Chitta, Zum Beispiel: kaya-kammannata, citta-kammannata.*
* In der deutschen Ausgabe dieses Buches von 1962 präzisiert der Autor eine ähnliche Tabelle: Die Bewusstseinsstromfaktoren „upekkha“ (Spalte B) und „lobha“ (Spalte C) sind durch eine gerade Linie verbunden; Die Begriffe „anottanna“ (B), „ottanna“ und „passaddhi“ (D) sollten offensichtlich jeweils als „anottappa“, ottappa“ und „passaddhi“ gelesen werden, wie im Text beschrieben ( Notiz Fahrbahn.)
Ansichten: 1431Kategorie: »
Lama Anagarika Govinda
PSYCHOLOGISCHE EINSTELLUNG
PHILOSOPHIEN DES FRÜHEN BUDDHISTUS
(GEMÄSS DER ABHIDHAMMA-TRADITION)
Übersetzung von A. I. Breslavets
Die psychologische Haltung der frühen buddhistischen Philosophie
(gemäß der Abhidhamma-Tradition). Patna-Universität, 1937
Psychologie des frühen Buddhismus
St. Petersburg: Verlag „Andreev and Sons“, 1993
Einführung
Erster Teil
URSPRUNG DER RELIGION
UND DIE FRÜHEN STADIEN DES INDISCHEN DENKENS
Selbstregularität religiöser Erfahrung
Zeitalter der Magie
Anthropomorphes Universum und Polytheismus
Gottproblem
Das Problem des Menschen
Zweiter Teil
Psychologie und Metaphysik im Lichte von Abhidhamma
Zwei Arten von Psychologie
3Bedeutung von Abhidhamma
Metaphysik und Empirismus
Wahrheit und Methode
Drei Ebenen der Erkenntnis
Der dritte Teil
VIER Edle WAHRHEITEN ALS AUSGANGSPUNKT
UND DIE LOGISCHE STRUKTUR DER BUDDHISTISCHEN PHILOSOPHIE
Die axiomatische Wahrheit über das Leiden
Ursache des Leidens
Vernichtung des Leidens
Der Weg der Befreiung
Vierter Teil
FUNDAMENTALE PRINZIPIEN
BUDDHISTISCHE LEHRE ÜBER BEWUSSTSEIN
Objekte des Bewusstseins
Struktur des Bewusstseins
Klassifizierung des Bewusstseins
Vier Arten „edler Persönlichkeit“ und das Problem des Leidens
Fünfter Teil
FAKTOREN DES BEWUSSTSEINS (CETASIKA)
Primäre oder dauerhaft neutrale Faktoren
Sekundäre neutrale Faktoren
Moralische Entscheidungsfaktoren und ihre Beziehungen
Sechster Teil
BEWUSSTSEINSFUNKTIONEN UND WAHRNEHMUNGSPROZESS
Die dynamische Natur des Bewusstseins
Funktionen des Bewusstseins und das Problem der Materie
Prozess der Wahrnehmung
Anwendungen
Systematische Darstellung der Psychologie des Abhidhamma
Klassen, Faktoren und Funktionen des Bewusstseins
Assoziatives, reflexives und intuitives Bewusstsein
Hetu: sechs Grundursachen
Alambana
Psychokosmisches System des Buddhismus
Bibliothek der Stiftung zur Förderung der psychischen Kultur (Kiew)
Wenn nun jemand fragt, ob ich überhaupt irgendeinen Standpunkt erkenne, wird die Antwort folgende sein:
Der Vollkommene ist frei von jeglicher Theorie, denn der Vollkommene hat verstanden, was der Körper ist, wie er entsteht und wie er verschwindet. Er verstand, was ein Gefühl ist, wie es entsteht und wie es verschwindet. Er erkannte, dass es mentale Strukturen (Samkhara) gibt, wie sie entstehen und wie sie verschwinden. Er verstand, was Bewusstsein ist, wie es entsteht und wie es verschwindet. Deshalb, sage ich, hat der Vollkommene die vollständige Befreiung erreicht, indem er alle Meinungen und Annahmen, alle Neigungen zum eitlen Konzept von „Ich“, „Mein“ verblasste, glättete, verschwand und sich von ihm befreite.
MAJJHIMANIKAYA, Einleitung Oft stellt sich die Frage: Ist der Buddhismus eine Religion, eine Philosophie, ein psychologisches System oder eine rein moralische Lehre? Die Antwort ließe sich etwa so formulieren: Als Erfahrung und praktische Umsetzung ist der Buddhismus eine Religion; als mentale, konzeptionelle Formulierung dieser Erfahrung – Philosophie; als Ergebnis des Systems der Selbstbeobachtung - Psychologie; und aus all dem folgt ein Verhaltensstandard, den wir Ethik (von innen betrachtet) oder Moral (von außen betrachtet) nennen.
Somit wird deutlich, dass Moral nicht der Ausgangspunkt ist, sondern eine Folge einer Weltanschauung oder einer religiösen Erfahrung sein muss. Daher beginnt der Achtfache Pfad des Buddha nicht mit der richtigen Rede, dem richtigen Verhalten oder dem richtigen Lebensunterhalt, sondern mit dem richtigen Wissen, mit einer aufgeschlossenen Sicht auf die Natur des Seins, der Dinge und des daraus resultierenden Zwecks. Denn „richtig“ (samma)* (wir werden dieses leider sehr abgenutzte, aber in der buddhistischen Literatur verwurzelte Wort verwenden) beinhaltet viel mehr als nur die einfache Übereinstimmung mit bestimmten wohlbekannten vorgefassten dogmatischen oder moralischen Vorstellungen; es bedeutet das, was über die Dualität und Gegensätze der einseitigen Sichtweise hinausgeht, die durch die Idee des „Ich“ bedingt ist. Mit anderen Worten: „Samma“ ist das, was perfekt und vollständig ist (weder dual noch einseitig), und in diesem Sinne ist es das, was jeder Bewusstseinsstufe perfekt entspricht. Die Bedeutung dieses Wortes wird im Ausdruck „sammasambuddha“ offenbart, der „vollständig“ oder „vollkommen“ erleuchtet und nicht „richtig“ (oder „wirklich“) erleuchtet bedeutet.** * Im Folgenden werden buddhistische Begriffe in vereinfachter Transliteration durch Kursivschrift gekennzeichnet von Pali.
** Hier und im Folgenden verwendet der Autor das veraltete englische Äquivalent von Erleuchtung (Erleuchtung, Erleuchtung), um den buddhistischen Sanskrit-Begriff Bodhi (Wurzel – Budh, vgl. Russisch – Erwachen) zu vermitteln, der unserer Meinung nach besser zu übersetzen ist als Erwachen, und dementsprechend Buddha – Erwachter, Bodhicitta – Einstellung zum Erwachen, Wille zum Erwachen (und nicht „erleuchteter Geist“), Buddhatva – Buddhaschaft, Erwachen (und nicht „Buddhaschaft“). Erleuchtung (Sanskrit Abhasvara) als privates spirituelles Phänomen entsteht bereits auf der Ebene des zweiten Dhyana. Unter Berücksichtigung dessen belassen wir hier weiterhin den Ausdruck „Erleuchtung“ als Ausdruck des Verständnisses des Autors für den Begriff Bodhi (Anmerkung von A.I. Breslavets).
Ein Mensch mit Rechter Sicht ist jemand, der die Dinge aus einer einseitigen, unparteiischen, unvoreingenommenen Perspektive betrachtet, der in seinen Absichten, Handlungen und Reden nicht nur seinen eigenen Standpunkt, sondern auch den Punkt erkennen und berücksichtigen kann der Sicht anderer.
Die Grundlage des Buddhismus ist also Wissen, und dies hat viele westliche Gelehrte dazu veranlasst, den Buddhismus als ein rein rationales System zu betrachten, das sich durch rationale erkenntnistheoretische Prinzipien erschöpft. Wissen ist im Buddhismus ein Produkt direkter Erfahrung (beginnend mit der Erfahrung des Leidens als einem überaus wertvollen universellen Axiom), denn nur das, was erlebt und nicht durchdacht wird, hat wahren Wert. Dabei erweist sich der Buddhismus als echte Religion, obwohl er mehr als nur ein Symbol des Glaubens ist. Der Buddhismus ist auch etwas mehr als reine Philosophie, obwohl er weder Vernunft noch Logik vernachlässigt, sondern sie so weit wie möglich nutzt. Es geht über das gewöhnliche psychologische System hinaus, da es sich nicht auf die reine Analyse und Klassifizierung gegebener psychischer Kräfte und Phänomene beschränkt, sondern deren Anwendung, Transformation und Entwicklung ihrer Transzendenz lehrt. Dementsprechend kann der Buddhismus nicht auf einen bestimmten Moralkodex oder eine „Anleitung zum Guten tun“ reduziert werden, sondern es ist notwendig, in die Sphäre jenseits von Gut und Böse vorzudringen, sich über jede Form von Dualismus zu erheben, in die Sphäre einer darauf basierenden Denkweise das tiefste Wissen und die innere Einkehr.
Die Philosophie und die „streng wissenschaftlichen Systeme“ der Psychologie konnten nie einen dominierenden Einfluss auf das Leben der Menschheit ausüben – nicht weil sie als Systeme ungeeignet waren und nicht weil es ihnen an wahrem Inhalt mangelte, sondern weil ihre Wahrheit rein theoretischer Natur war Wert, der aus dem Verstand, nicht aus dem Herzen, entsteht, vom Intellekt geschaffen und im Leben nicht verwirklicht wird.
Offensichtlich reicht die Wahrheit allein nicht aus, um einen starken Einfluss auf die Menschheit auszuüben. Damit eine solche Wirkung möglich ist, muss die Wahrheit mit dem Atem des Lebens erfüllt sein. Die abstrakte Wahrheit ist, dass es sich um Vitamin-freie Konservennahrung handelt, die zwar unseren Geschmack befriedigt und unseren Körper vorübergehend unterstützt, uns aber kein langes Leben ermöglichen kann. Lebewesen werden unserem Geist nur durch jene religiösen Impulse geschenkt, die im Menschen den Wunsch nach Erfüllung wecken und zu seinem Ziel führen. Es besteht kein Zweifel (die Geschichte des Buddhismus beweist dies), dass diese Impulse im Buddhismus ebenso stark vertreten sind wie seine philosophischen Konzepte.
(Der Grund, warum einige zögern, den Buddhismus als Religion zu bezeichnen, liegt darin, dass sie Religion mit Dogmen, mit einer bestimmten organisierten Tradition, mit dem Glauben an göttliche Offenbarung und ähnlichen Ansichten verwechseln, die im Buddhismus natürlich nicht zu finden sind.) Deshalb wann Wenn wir über buddhistische Philosophie sprechen, müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass wir uns nur mit der theoretischen Seite des Buddhismus befassen und nicht mit dem Buddhismus als Ganzes. Und so wie es unmöglich ist, über den Buddhismus zu sprechen, ohne sein philosophisches System zu berühren, ist es auch unmöglich, die buddhistische Philosophie isoliert von ihrer religiösen Praxis zu verstehen. Religion ist ein Weg, der durch praktische Erfahrung geschaffen wird (so wie eine Straße durch ständiges Gehen entsteht). Philosophie ist die Ausrichtung auf eine Richtung, während Psychologie die Analyse der Kräfte und Bedingungen ist, die den Fortschritt auf diesem Weg begünstigen oder behindern. Doch bevor wir uns mit der Richtung befassen, in die dieser Weg führt, blicken wir zurück dorthin, wo er beginnt.
>> Bibliothek der Stiftung zur Förderung der psychischen Kultur (Kiew) >> Wer das Dhamma kennt, streitet nie mit der Welt.
Was die Weisen dieser Welt für nicht-existent erklärt haben, lehre ich auch als nicht-existent.
Und was die Weisen dieser Welt als existierend erkannt haben, das lehre ich als existierend.
SAMYUTTA NIKAYA, III, Erster Teil DER URSPRUNG DER RELIGION UND DIE FRÜHEN STADIEN DES INDISCHEN DENKENS 1. SELBSTLegalität religiöser Erfahrung Religionen können nicht vom Menschen geschaffen werden. Sie sind der formale Ausdruck eines überindividuellen inneren Erlebens, das sich über lange Zeiträume herauskristallisiert hat. Sie haben den Charakter einer hohen Gemeinschaft, Einbindung in das breiteste Bewusstsein. Sie finden ihre entscheidende Form des Ausdrucks und der Erfüllung in den am weitesten entwickelten und gefühlvollsten Köpfen, die fähig sind, am überindividuellen Leben ihrer Mitmenschen (wenn nicht sogar der gesamten Menschheit) teilzunehmen. Damit steht Religion ungleich höher als das übliche „kollektive Denken“, das intellektuell geschaffenen und organisierten Massenbewegungen innewohnt und daher nicht dem überindividuellen Bewusstsein, sondern im Gegenteil der subindividuellen Stufe angehört der Herdenmentalität.
Religionen können nicht intellektuell geschaffen oder gemacht werden, sie entwickeln sich wie eine Pflanze nach bestimmten Gesetzen ihrer Natur: Sie sind die natürliche Manifestation des Geistes, an dem der Einzelne teilnimmt. Die Universalität ihrer Gesetze bedeutet jedoch nicht die Gleichheit ihrer Wirkung, da dasselbe Gesetz unter unterschiedlichen Bedingungen wirkt. Daher können wir zwar über die Parallelität der religiösen Bewegung (die wir „Entwicklung“ nennen) und vielleicht sogar über die Parallelität religiöser Ideen sprechen, aber niemals über deren Identität. Gerade dort, wo Wörter oder Symbole ähnlich sind, ist die ihnen zugrunde liegende Bedeutung oft völlig unterschiedlich, da die Identität der Form nicht die Identität des Inhalts garantiert, da die Bedeutung jeder Form von den mit ihr verbundenen Assoziationen abhängt.
Daher ist es ebenso sinnlos, danach zu streben, alle Religionen auf einen Nenner zu bringen, als alle Bäume eines Gartens gleich zu machen oder ihre Unterschiede als Unvollkommenheiten zu erklären. So wie die Schönheit eines Gartens in der Vielfalt und Vielfalt seiner Bäume und Blumen liegt, von denen jeder sein eigenes Modell der Vollkommenheit hat, so enthält der Garten des Geistes seine Schönheit und seinen lebendigen Sinn in der Vielfalt und Vielseitigkeit der Formen von Erfahrung und Ausdruck, die ihm innewohnen. Und so wie alle Blumen eines Gartens auf demselben Boden wachsen, dieselbe Luft atmen und nach derselben Sonne greifen, so wachsen alle Religionen auf demselben Boden der inneren Realität und werden von denselben kosmischen Kräften genährt. Das ist ihre Gemeinsamkeit. Ihr Charakter und ihre besondere Schönheit (in der sich ihr inhärenter Wert manifestiert) basieren auf den Punkten, in denen sie sich voneinander unterscheiden und aufgrund derer jede Art ihre eigene Vollkommenheit besitzt.
Diejenigen, die versuchen, diese Unterschiede zu glätten, indem sie sie als Missverständnisse oder Fehlinterpretationen bezeichnen, und danach streben, sich einer abstrakten Übereinstimmung oder absoluten Einheit zu nähern, die die wahrhaft existierende Realität sein soll, sind wie Kinder, die in einem erfolglosen Versuch, sie zu finden, die Blütenblätter einer Blume zupfen die „echte“ Blume.
Wenn mehrere Künstler den gleichen Gegenstand oder die gleiche Landschaft darstellen, dann schafft jeder von ihnen ein anderes Bild als der andere. Würden jedoch mehrere Personen dasselbe Objekt mit derselben Belichtung fotografieren, bekäme jeder von ihnen das gleiche Bild. Hier ist diese Präzision kein Zeichen von Überlegenheit, sondern ein Zeichen von mangelnder Kreativität und gar Leben. Und im Gegenteil: Gerade die unterschiedliche künstlerische Wahrnehmung verleiht einem Kunstwerk seinen besonderen Wesenswert. Einzigartigkeit und Originalität sind Zeichen von Genialität, Genialität in allen Lebensbereichen. Genauigkeit und Standardisierung sind Zeichen von Mechanik, Mittelmäßigkeit und spiritueller Stagnation.
|
Serie: „Welt des Ostens“ Das Buch „Die psychologische Position der Philosophie des frühen Buddhismus“ wurde von einem der größten spirituellen Weisen geschrieben, der die Tradition des tibetischen Buddhismus repräsentiert, einem tiefen Experten der östlichen und westlichen Philosophie, einem Reisenden und einer Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, einem Künstler und Dichter, Lama Anagarika Govinda. Als Verbreiter der Lehren Gautama Buddhas im Westen versuchte Govinda, die verborgensten Aspekte der buddhistischen Tradition aufzudecken. Das Buch „Die psychologische Position der Philosophie des frühen Buddhismus“ gilt als brillantes Beispiel spiritueller Literatur, das die Tiefe der Präsentation und die Zugänglichkeit des Studiums vereint. Das Buch zeigt, was aus Sicht des frühen Buddhismus menschliche Natur, das allgemeine Bild der Welt, der Zweck des Menschen, spirituelle Praktiken, die den Schüler den Höhen der Errungenschaft näher bringen, die Verbindung zwischen den Lehren von Buddha Gautamys und anderen religiösen und mystischen Systemen und Traditionen sowie die historischen Phasen von religiöse Suche werden nachgebildet. In diesem Buch hat Anagarika Govinda versucht, die grundlegenden... Herausgeber: „Belovodye“ (2007) Format: 70x90/16, 224 Seiten.
ISBN: 978-5-93454-077-7 Auf Ozon |
Siehe auch in anderen Wörterbüchern:
- - das Studium des menschlichen Bewusstseins, Verhaltens und der Kultur geistiger Aktivität, um höhere Bewusstseinszustände zu erreichen [nicht in der Quelle 261 Tage], basierend auf buddhistischen Lehren. Trotz der Tatsache, dass buddhistische Lehren... ... Wikipedia
VAJRAYANA- [Sanskrit. Diamantwagen, Diamantweg; andere Namen Tantra, Tantrayana, tantrischer Buddhismus, Mantrayana], eine der drei Hauptrichtungen des Buddhismus neben Hinayana (oder Theravada) und Mahayana. V. wird oft als eine der Mahayana-Schulen angesehen (2 ... Orthodoxe Enzyklopädie
AVALOKITESVARA- Avalokiteshvara [Sanskrit. ein Herr, der gnädig auf Wesen blickt, in einer anderen Lesart ein Herr, der auf die Bitten leidender Wesen hört], im Mahayana-Buddhismus (Großes Fahrzeug) ein erleuchtetes Wesen, das nach Erlangung der Erleuchtung ein Gelübde abgelegt hat, nicht in ... zu gehen. ... Orthodoxe Enzyklopädie
Die Skulptur „Der Denker“ (französisch Le Penseur) von Auguste Rodin, die oft als Symbol der Philosophie verwendet wird ... Wikipedia
- „Es ist sehr schwierig und vielleicht sogar unmöglich, eine Definition des Wortes „Gott“ zu geben, die alle Bedeutungen dieses Wortes und seiner Äquivalente in anderen Sprachen umfasst. Auch wenn wir Gott ganz allgemein als „übermenschlich oder...“ definieren. Philosophische Enzyklopädie
- ... Wikipedia
Liste der auf Russisch schreibenden Sinologen Dies ist eine offizielle Liste des Staates ... Wikipedia
BUDDHISMUS- ein Glaubensbekenntnis, das in Dr. Indien ca. grau Chr. und während der anschließenden Verbreitung und Institutionalisierung außerhalb des südasiatischen Raums wurde sie zu einer der Weltreligionen. Latinisierter Begriff „B.“ ist nicht… … Orthodoxe Enzyklopädie
Der Artikel ist Teil einer Artikelserie über Zen... Wikipedia
I Medizin Medizin ist ein System wissenschaftlicher Erkenntnisse und praktischer Aktivitäten, dessen Ziele darin bestehen, die Gesundheit zu stärken und zu erhalten, das Leben der Menschen zu verlängern sowie menschliche Krankheiten zu verhindern und zu behandeln. Um diese Aufgaben zu erfüllen, studiert M. die Struktur und... ... Medizinische Enzyklopädie
– (in Hindi Bharat) der offizielle Name der Republik Indien. I. Allgemeine Informationen I. ist ein Staat in Südasien, im Becken des Indischen Ozeans. I. liegt an den wichtigsten See- und Luftverkehrsverbindungen,... ... Große sowjetische Enzyklopädie
Psychologische Haltung der Philosophie des frühen Buddhismus. Lama Anagarika Govinda. Oft stellt sich die Frage: Ist der Buddhismus eine Religion, eine Philosophie, ein psychologisches System oder eine rein moralische Lehre? Die Antwort ließe sich etwa so formulieren: Als Erfahrung und praktische Umsetzung ist der Buddhismus eine Religion; als mentale, konzeptionelle Formulierung dieser Erfahrung – Philosophie; als Ergebnis des Systems der Selbstbeobachtung - Psychologie; und aus all dem folgt ein Verhaltensstandard, den wir Ethik (von innen betrachtet) oder Moral (von außen betrachtet) nennen.
Lesen Sie das Buch „Psychological Attitude of the Philosophy of Early Buddhism“ online
NAMO TASSA
BHAGAVATO
ARAHATO
SAMMA-
SAMBUDDHASSA
Wenn nun jemand fragt, ob ich überhaupt irgendeinen Standpunkt erkenne, wird die Antwort folgende sein:
Der Vollkommene ist frei von jeglicher Theorie, denn der Vollkommene hat verstanden, was der Körper ist, wie er entsteht und wie er verschwindet. Er verstand, was ein Gefühl ist, wie es entsteht und wie es verschwindet. Er erkannte, dass es mentale Strukturen (Samkhara) gibt, wie sie entstehen und wie sie verschwinden. Er verstand, was Bewusstsein ist, wie es entsteht und wie es verschwindet. Deshalb, sage ich, hat der Vollkommene die vollständige Befreiung erreicht, indem er alle Meinungen und Annahmen, alle Neigungen zum eitlen Konzept von „Ich“, „Mein“ verblasste, glättete, verschwand und sich von ihm befreite.
MAJJHIMA-NIKAYA, 72
Einführung
Oft stellt sich die Frage: Ist der Buddhismus eine Religion, eine Philosophie, ein psychologisches System oder eine rein moralische Lehre? Die Antwort ließe sich etwa so formulieren: Als Erfahrung und praktische Umsetzung ist der Buddhismus eine Religion; als mentale, konzeptionelle Formulierung dieser Erfahrung – Philosophie; als Ergebnis des Systems der Selbstbeobachtung - Psychologie; und aus all dem folgt ein Verhaltensstandard, den wir Ethik (von innen betrachtet) oder Moral (von außen betrachtet) nennen.
Somit wird deutlich, dass Moral nicht der Ausgangspunkt ist, sondern eine Folge einer Weltanschauung oder einer religiösen Erfahrung sein muss. Daher beginnt der Achtfache Pfad des Buddha nicht mit der richtigen Rede, dem richtigen Verhalten oder dem richtigen Lebensunterhalt, sondern mit dem richtigen Wissen, mit einer aufgeschlossenen Sicht auf die Natur des Seins, der Dinge und des daraus resultierenden Zwecks. Denn „richtig“ (samma)* (wir werden dieses leider sehr abgenutzte, aber in der buddhistischen Literatur verwurzelte Wort verwenden) beinhaltet viel mehr als nur die einfache Übereinstimmung mit bestimmten wohlbekannten vorgefassten dogmatischen oder moralischen Vorstellungen; es bedeutet das, was über die Dualität und Gegensätze der einseitigen Sichtweise hinausgeht, die durch die Idee des „Ich“ bedingt ist. Mit anderen Worten: „Samma“ ist das, was perfekt und vollständig ist (weder dual noch einseitig), und in diesem Sinne ist es das, was jeder Bewusstseinsstufe perfekt entspricht. Die Bedeutung dieses Wortes wird im Ausdruck „samma-sambuddha“ offenbart, der „vollständig“ oder „vollkommen“ erleuchtet und nicht „richtig“ (oder „wirklich“) erleuchtet bedeutet.** * Im Folgenden werden buddhistische Begriffe in Kursivschrift verwendet in vereinfachter Transliteration aus Pali.
** Hier und im Folgenden verwendet der Autor das veraltete englische Äquivalent von Erleuchtung (Erleuchtung, Erleuchtung), um den buddhistischen Sanskrit-Begriff Bodhi (Wurzel – Budh, vgl. Russisch – Erwachen) zu vermitteln, der unserer Meinung nach besser zu übersetzen ist als Erwachen, und dementsprechend Buddha – Erwachter, Bodhicitta – Einstellung zum Erwachen, Wille zum Erwachen (und nicht „erleuchteter Geist“), Buddhatva – Buddhaschaft, Erwachen (und nicht „Buddhaschaft“). Erleuchtung (Sanskrit Abhasvara) als privates spirituelles Phänomen entsteht bereits auf der Ebene des zweiten Dhyana. Unter Berücksichtigung dessen belassen wir hier weiterhin den Ausdruck „Erleuchtung“ als Ausdruck des Verständnisses des Autors für den Begriff Bodhi (Anmerkung von A.I. Breslavets).
Ein Mensch mit Rechter Sicht ist jemand, der die Dinge aus einer einseitigen, unparteiischen, unvoreingenommenen Perspektive betrachtet, der in seinen Absichten, Handlungen und Reden nicht nur seinen eigenen Standpunkt, sondern auch den Punkt erkennen und berücksichtigen kann der Sicht anderer.
Die Grundlage des Buddhismus ist also Wissen, und dies hat viele westliche Gelehrte dazu veranlasst, den Buddhismus als ein rein rationales System zu betrachten, das sich durch rationale erkenntnistheoretische Prinzipien erschöpft. Wissen ist im Buddhismus ein Produkt direkter Erfahrung (beginnend mit der Erfahrung des Leidens als einem überaus wertvollen universellen Axiom), denn nur das, was erlebt und nicht durchdacht wird, hat wahren Wert. Dabei erweist sich der Buddhismus als echte Religion, obwohl er mehr als nur ein Symbol des Glaubens ist. Der Buddhismus ist auch etwas mehr als reine Philosophie, obwohl er weder Vernunft noch Logik vernachlässigt, sondern sie so weit wie möglich nutzt. Es geht über das gewöhnliche psychologische System hinaus, da es sich nicht auf die reine Analyse und Klassifizierung gegebener psychischer Kräfte und Phänomene beschränkt, sondern deren Anwendung, Transformation und Entwicklung ihrer Transzendenz lehrt. Dementsprechend kann der Buddhismus nicht auf einen bestimmten Moralkodex oder eine „Anleitung zum Guten tun“ reduziert werden, sondern es ist notwendig, in die Sphäre jenseits von Gut und Böse vorzudringen, sich über jede Form von Dualismus zu erheben, in die Sphäre einer darauf basierenden Denkweise das tiefste Wissen und die innere Einkehr.
Die Philosophie und die „streng wissenschaftlichen Systeme“ der Psychologie konnten nie einen dominierenden Einfluss auf das Leben der Menschheit ausüben – nicht weil sie als Systeme ungeeignet waren und nicht weil es ihnen an wahrem Inhalt mangelte, sondern weil ihre Wahrheit rein theoretischer Natur war Wert, der aus dem Verstand, nicht aus dem Herzen, entsteht, vom Intellekt geschaffen und im Leben nicht verwirklicht wird.
Offensichtlich reicht die Wahrheit allein nicht aus, um einen starken Einfluss auf die Menschheit auszuüben. Damit eine solche Wirkung möglich ist, muss die Wahrheit mit dem Atem des Lebens erfüllt sein. Die abstrakte Wahrheit ist, dass es sich um Vitamin-freie Konservennahrung handelt, die zwar unseren Geschmack befriedigt und unseren Körper vorübergehend unterstützt, uns aber kein langes Leben ermöglichen kann. Lebewesen werden unserem Geist nur durch jene religiösen Impulse geschenkt, die im Menschen den Wunsch nach Erfüllung wecken und zu seinem Ziel führen. Es besteht kein Zweifel (die Geschichte des Buddhismus beweist dies), dass diese Impulse im Buddhismus ebenso stark vertreten sind wie seine philosophischen Konzepte.
(Der Grund, warum einige zögern, den Buddhismus als Religion zu bezeichnen, liegt darin, dass sie Religion mit Dogmen, mit einer bestimmten organisierten Tradition, mit dem Glauben an göttliche Offenbarung und ähnlichen Ansichten verwechseln, die im Buddhismus natürlich nicht zu finden sind.)
Wenn wir über buddhistische Philosophie sprechen, müssen wir uns daher darüber im Klaren sein, dass wir uns nur mit der theoretischen Seite des Buddhismus befassen und nicht mit dem Buddhismus als Ganzes. Und so wie es unmöglich ist, über den Buddhismus zu sprechen, ohne sein philosophisches System zu berühren, ist es auch unmöglich, die buddhistische Philosophie isoliert von ihrer religiösen Praxis zu verstehen. Religion ist ein Weg, der durch praktische Erfahrung geschaffen wird (so wie eine Straße durch ständiges Gehen entsteht). Philosophie ist die Ausrichtung auf eine Richtung, während Psychologie die Analyse der Kräfte und Bedingungen ist, die den Fortschritt auf diesem Weg begünstigen oder behindern. Doch bevor wir uns mit der Richtung befassen, in die dieser Weg führt, blicken wir zurück dorthin, wo er beginnt.
Wer das Dhamma kennt, streitet nie mit der Welt.
Was die Weisen dieser Welt für nicht existent erklärten,
Ich unterrichte darüber, als ob es nicht existierte.
Und was die Weisen dieser Welt als existierend erkannten,
Ich unterrichte darüber, als ob es existieren würde.
SAMYUTTA NIKAYA, III, 238
Erster Teil
URSPRUNG DER RELIGION
UND DIE FRÜHEN STADIEN DES INDISCHEN DENKENS
1. SELBSTREGELMÄßIGKEIT DER RELIGIÖSEN ERFAHRUNG
Religionen können nicht von Menschen geschaffen werden. Sie sind der formale Ausdruck eines überindividuellen inneren Erlebens, das sich über lange Zeiträume herauskristallisiert hat. Sie haben den Charakter einer hohen Gemeinschaft, Einbindung in das breiteste Bewusstsein. Sie finden ihre entscheidende Form des Ausdrucks und der Erfüllung in den am weitesten entwickelten und gefühlvollsten Köpfen, die fähig sind, am überindividuellen Leben ihrer Mitmenschen (wenn nicht sogar der gesamten Menschheit) teilzunehmen. Damit steht Religion ungleich höher als das übliche „kollektive Denken“, das intellektuell geschaffenen und organisierten Massenbewegungen innewohnt und daher nicht dem überindividuellen Bewusstsein, sondern im Gegenteil der subindividuellen Stufe angehört der Herdenmentalität.
Religionen können nicht intellektuell geschaffen oder gemacht werden, sie entwickeln sich wie eine Pflanze nach bestimmten Gesetzen ihrer Natur: Sie sind die natürliche Manifestation des Geistes, an dem der Einzelne teilnimmt. Die Universalität ihrer Gesetze bedeutet jedoch nicht die Gleichheit ihrer Wirkung, da dasselbe Gesetz unter unterschiedlichen Bedingungen wirkt. Daher können wir zwar über die Parallelität der religiösen Bewegung (die wir „Entwicklung“ nennen) und vielleicht sogar über die Parallelität religiöser Ideen sprechen, aber niemals über deren Identität. Gerade dort, wo Wörter oder Symbole ähnlich sind, ist die ihnen zugrunde liegende Bedeutung oft völlig unterschiedlich, da die Identität der Form nicht die Identität des Inhalts garantiert, da die Bedeutung jeder Form von den mit ihr verbundenen Assoziationen abhängt.
Daher ist es ebenso sinnlos, danach zu streben, alle Religionen auf einen Nenner zu bringen, als alle Bäume eines Gartens gleich zu machen oder ihre Unterschiede als Unvollkommenheiten zu erklären. So wie die Schönheit eines Gartens in der Vielfalt und Vielfalt seiner Bäume und Blumen liegt, von denen jeder sein eigenes Modell der Vollkommenheit hat, so enthält der Garten des Geistes seine Schönheit und seinen lebendigen Sinn in der Vielfalt und Vielseitigkeit der Formen von Erfahrung und Ausdruck, die ihm innewohnen. Und so wie alle Blumen eines Gartens auf demselben Boden wachsen, dieselbe Luft atmen und nach derselben Sonne greifen, so wachsen alle Religionen auf demselben Boden der inneren Realität und werden von denselben kosmischen Kräften genährt. Das ist ihre Gemeinsamkeit. Ihr Charakter und ihre besondere Schönheit (in der sich ihr inhärenter Wert manifestiert) basieren auf den Punkten, in denen sie sich voneinander unterscheiden und aufgrund derer jede Art ihre eigene Vollkommenheit besitzt.