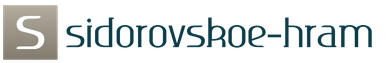Seine populären Urteile über Gott oder Götter haben den gleichen Charakter; Allerdings gehen diese Urteile, insbesondere im Hinblick auf den Vorsehungsglauben und die Theodizee, über die streng konsequenten Schlussfolgerungen seines Systems hinaus; Dies ist in Platons Weltanschauung umso einfacher, als er die kritisch logischen und konkreten Formen dieses Glaubens nicht miteinander verglich und insbesondere die viel später aufkommende Frage nach dem persönlichen Charakter der Gottheit nicht aufwarf . Neben der Gottheit im absoluten Sinne nennt Platon die Ideen ewige Götter und den Kosmos und die Sterne sichtbare Götter; Gleichzeitig verbirgt der Philosoph nicht die Tatsache, dass er die Gottheiten der Mythologie für Geschöpfe der Fantasie hält, und verurteilt viele Mythen scharf, die einen unmoralischen und einer Gottheit unwürdigen Inhalt haben.
Dennoch will er die hellenische Religion als Staatsreligion bewahren und macht ihre Mythen zur ersten Grundlage der Bildung, unter der Bedingung, dass sie von den angedeuteten schädlichen Verunreinigungen gereinigt werden; er fordert keine Vertreibung, sondern nur eine Reform des Volksglaubens.
Was die Kunst betrifft, so bewertet Platon sie wie die Religion vor allem unter dem Gesichtspunkt ihres ethischen Einflusses. Gerade weil er selbst ein Künstler-Philosoph war, ist er nicht in der Lage, reine Kunst zu schätzen, die keinem fremden Zweck dient. Er reduziert den Begriff des Schönen in sokratischer Manier ohne genauere Einteilung seiner Ursprünglichkeit auf den Begriff des Guten; er betrachtet Kunst als Nachahmung, aber nicht als Nachahmung des Wesens einer Sache, sondern nur ihrer sinnlichen Manifestation; und er wirft der Kunst vor, dass sie, aus einer unklaren Inspiration hervorgegangen, gleichermaßen unser Interesse am Falschen und Wahren, am Bösen und Guten erfordert, dass sie in vielen ihrer Schöpfungen, wie besonders in der Komödie, unseren niederen Neigungen schmeichelt und mit seinem bunten Spiel schadet es der Einfachheit und Integrität des Charakters.
Um die höchste Rechtfertigung zu erhalten, muss sich die Kunst den Aufgaben der Philosophie unterwerfen; es sollte als Mittel zur moralischen Erziehung betrachtet werden; Seine höchste Aufgabe sollte es sein, die Liebe zur Tugend und die Abneigung gegen das Laster zu wecken. An diesem Maßstab, mit dem Platon in seinen beiden großen politischen Abhandlungen die Kunst und vor allem Poesie und Musik bis ins kleinste Detail unterordnen will, soll sich die staatliche Verwaltung und Aufsicht orientieren; Er selbst legt den gleichen Maßstab an und vertreibt aus seinem Staat nicht nur alle unmoralischen und unwürdigen Götter- und Heldengeschichten, sondern auch jede raffinierte und verweichlichte Musik sowie alle nachahmende Poesie und damit auch Homer.
Ebenso fordert Platon, dass die Redekunst, deren übliche Ausübung er entschieden ablehnt, in ein Hilfsmittel der Philosophie umgewandelt werden soll.
Frühgriechisch Ästhetik war kosmologisch, d.h. Schönheit, Harmonie, Proportion und Maß waren in erster Linie Eigenschaften des Universums. Pythagoräische Ästhetik: Zahl ist der Anfang der Existenz, die Grundlage des kosmischen Maßes. Die Pythagoräer entdeckten das gleiche Zahlenprinzip in der Musik und daher stellten sie sich den gesamten Kosmos als musikalisch-numerische Harmonie vor. Die Sophisten verkündeten, dass „der Mensch das Maß aller Dinge“ sei, auch der ästhetischen Haltung. Die Quelle der Schönheit ist nicht die Welt, sondern der Mensch mit seiner Fähigkeit, etwas als schön wahrzunehmen. Gorgias: „Schön ist, was Auge und Ohr erfreut.“ Subjektivistischer (Schönheit ist eine subjektive Angelegenheit), relativistischer (Schönheit ist eine relative Sache), hedonistischer (Schönheit ist, was man mag) Ansatz zum Verständnis von Schönheit. Sokrates: Die Schönheit der Dinge ist relativ (ein schöner Affe ist nicht mit einem schönen Menschen zu vergleichen, geschweige denn mit einem schönen Gott), daher sollte man Schönheit an sich finden, eine allgemeine Definition von Schönheit. Das allgemeine Prinzip der Schönheit ist Zweckmäßigkeit. Da die Welt intelligent und harmonisch angeordnet ist (die Welt ist ein Kosmos), ist jedes Ding in ihr für einen bestimmten Zweck bestimmt, was sie schön macht. Schöne Augen sind diejenigen, die besser sehen. Platon glaubte, dass die Aufgabe der Ästhetik darin bestehe, das Schöne als solches zu begreifen. Es ist nicht in schönen Dingen enthalten (einem schönen Mädchen, einem schönen Pferd, einer schönen Vase) – es ist eine Idee, es ist absolut und existiert im „Reich der Ideen“. Für Aristoteles ist Schönheit die Idee einer Sache – ihre Form, wenn Materie geformt wird, entsteht ein schönes Objekt (so wird Marmor, nachdem er die Idee des Künstlers wahrgenommen hat, zu einer Statue). Kunst ist eine Aktivität, durch eine Katze. Es entstehen Dinge, deren Form in der Seele ist. Das Wesen der Kunst ist nach Aristoteles die Mimesis (Nachahmung), die Kunst ahmt die Realität nach. Dabei handelt es sich jedoch nicht um blindes Kopieren, sondern um eine schöpferische Identifikation des typischen, allgemeinen Ideals mit seiner zwingenden Verkörperung im Material.
Kapitel 6. Platons ästhetisches Konzept.
Nach Sokrates glaubte Platon, dass die Aufgabe der Ästhetik darin bestehe, das Schöne als solches zu begreifen. Platon betrachtet schöne Dinge (ein schönes Mädchen, ein schönes Pferd, eine schöne Vase) und kommt zu dem Schluss, dass Schönheit nicht in ihnen enthalten ist. Das Schöne ist eine Idee, es ist absolut und existiert im „Reich der Ideen“. Sie können dem Verständnis des Schönheitsgedankens näher kommen durch: - Berücksichtigung schöner Körper; - schöne Seelen bewundern (Schönheit – und spirituelles Phänomen); - Leidenschaft für die Schönheit der Wissenschaft (Bewunderung schöner Gedanken, die Fähigkeit, schöne Abstraktionen zu sehen); - Betrachtung der idealen Welt der Schönheit, der eigentlichen Vorstellung von Schönheit. Ein wahres Verständnis der Schönheit ist dank Vernunft und intellektueller Kontemplation möglich, dies ist eine Art übersinnliche Erfahrung. Platon erklärt den Wunsch nach Schönheit mit Hilfe der Eroslehre. Eros, der Sohn des Reichtumsgottes Poros und der Bettlerin Penia, ist unhöflich und ungepflegt, hat aber hohe Ambitionen. Wie er sehnt sich der Mensch als irdisches Geschöpf nach Schönheit. Platonische Liebe (Eros) ist Liebe zur Idee der Schönheit; Die platonische Liebe zu einer Person ermöglicht es Ihnen, in einer bestimmten Person ein Spiegelbild absoluter Schönheit zu sehen. Im Lichte von Platons idealistischer Ästhetik (einer Ästhetik, die Schönheit als eine ideale Essenz ansieht) hat Kunst wenig Wert. Sie imitiert Dinge, während die Dinge selbst die Nachahmung von Ideen sind, es zeigt sich, dass Kunst „eine Nachahmung der Nachahmung“ ist. Die Ausnahme bildet die Poesie, denn die Rhapsode wird im Moment der Kreativität von Ekstase erfasst, die es ihr ermöglicht, von göttlicher Inspiration erfüllt zu werden und sich mit der ewigen Schönheit zu verbinden. In seinem Idealzustand wollte Platon alle Künste abschaffen, ließ aber diejenigen übrig, die einen pädagogischen Wert haben und den Bürgergeist fördern. Nur vollkommene Bürger wiederum können sich an solch „richtiger Kunst“ erfreuen.
Planen:
EinführungS. 1-4
Platons Rede gegen die DichterS. 4-12
Aristoteles' Verteidigung der DichterS. 12-18
AbschlussSeite 19
ReferenzlisteSeite 20
Einführung
Im politischen und kulturellen Leben Griechenlands spielte die Kunst eine so große und offensichtliche Rolle, dass ein ganzes System zur Bildung der herrschenden Klasse der antiken Gesellschaft auf ihr basierte. Platon und Aristoteles, die alle brennenden Fragen unserer Zeit so ausführlich diskutierten, konnten natürlich die Frage nicht ignorieren, welche Kunst, auf welchen Teil der Gesellschaft, auf welche Weise und mit welchem Ergebnis wirkt, wie sie die Gefühle prägt und Gedanken von Menschen, beeinflusst ihre Moral, ihr politisches Bewusstsein und ihr Verhalten. Platon selbst war ein äußerst künstlerisch begabter Mensch – ein großer Meister der Worte und der dialogischen Form, ein erstklassiger Künstler und ein unübertroffener Universalgelehrter. Platons großes Verdienst besteht darin, dass er einer der ersten war, der in der Kunst ein Mittel zur Erziehung eines bestimmten Menschentyps sah. Der moderne Typus entsprach nicht Platons Ideal, und in seinen Dialogen schuf er eine neue Lehre, die teilweise in verschiedenen Epochen des vorplatonischen Griechenlands wurzelte, aber im Allgemeinen immer auf eine „ideale“ Zukunft abzielte, in der ein neuer „idealer“ Mensch entstehen sollte leben in einem „idealen“ Zustand, erzogen durch „ideale“ Kunst.
Als Schüler des Sokrates folgt Platon weitgehend dessen Ästhetik, geht aber noch viel weiter. Das Verdienst von Sokrates besteht darin, dass er den Zusammenhang zwischen dem Ästhetischen und dem Ethischen, dem Moralischen und dem Guten betonte. Sein Ideal ist ein Mensch mit einem wunderbaren Geist. Für Platon wird Kunst bereits zum Kriterium der Moral, der sozialen Ordnung, des politischen Wohlergehens im Staat und zugleich zum Instrument der Gerechtigkeit. denn alles muss ihr unterworfen sein.
Damit zeichnet sich ein Haupttrend ab, in dem sich Platons ästhetische Lehre weiterentwickelt – Kunst als Mittel der Bildung und Einflussnahme auf das gesellschaftspolitische Leben.
Was könnte die Freizeit aller Menschen füllen, die Freizeit hatten (auch derjenigen, die einer produktiven Tätigkeit nachgingen)? Natürlich Kunst, aber auf eine bestimmte Weise organisierte Kunst, die darauf abzielt, das Bewusstsein der Menschen so zu beeinflussen, dass die Struktur ihrer Gefühle und Gedanken dem Ideal der antiken Sklavenhalter-Polis entspricht. Dies bedeutet, dass die Frage der Kunst zu Platons Zeiten zwangsläufig als eine unmittelbar politische Frage auftauchen musste. 1
Aristoteles schreibt der Kunst die Funktion zu, das geistige Gleichgewicht wiederherzustellen . Indem wir ein Kunstwerk (z. B. ein Musikstück oder ein Theaterstück) erleben, können wir Harmonie und Frieden in uns selbst wiederherstellen und letztendlich unseren Geist (Geist) veredeln. Es gibt also zwei Interpretationen:
in dem Sinne, dass es uns hilft, „Dampf abzulassen“. Indem wir das Drama mit seinen Helden, Bösewichten und großen Gefühlen erleben, werden wir von unterdrückten Leidenschaften und unkontrollierbaren Emotionen befreit, erlangen Harmonie und führen unser Leben im Einklang mit dem Ideal einer ausgeglichenen „goldenen Mitte“ fort. Hierbei handelt es sich um eine therapeutische Interpretation im Sinne einer medizinischen Therapie, die auf der Flüssigkeitslehre basiert. Wer außergewöhnlich starke und intensive Erfahrungen macht, kann sich durch die Kunst davon befreien und so eine Art spirituellen Aderlass erleben. (Und wer zu schwache Gefühle hat, kann diese emotional stärken).
Kunst ist kathartisch in dem Sinne, dass wir als Menschen durch unsere Auseinandersetzung mit der Kunst gereinigt und gebildet werden. Hier geht es nicht vor allem darum, bestimmte Emotionen loszuwerden (wie beim spirituellen Aderlass!), sondern darum, dass wir mit Hilfe unserer Erfahrungen unseren Geist (Geist) veredeln. Unser Ziel ist daher eine persönliche Verbesserung, die über das Übliche hinausgeht.
Nach Aristoteles ist Kunst für den Menschen, der das Kunstwerk erlebt, ein Gut (oder Zweck) an sich. Für einen Künstler oder Performer kann der kreative Prozess auch an sich gut sein. Gleichzeitig endet der kreative Prozess mit der Entstehung eines Kunstwerks. Folglich ist der kreative Prozess durch ein Ziel vorgegeben, das außerhalb des Prozesses selbst liegt.
Aristoteles ist berühmt für sein Werk „Poetik“ . Darin erörtert er unter anderem die klassische Bedingung, dass das Drama durch das Erfordernis der Einheit von Handlung, Zeit und Ort gekennzeichnet sein sollte. 2
Welterschaffung
„Der wünschte, dass alles gut und möglichst nichts schlecht sein würde, Gott sorgte für alle sichtbaren Dinge, die nicht in Ruhe waren, sondern in unharmonischer und ungeordneter Bewegung; Er brachte sie aus der Unordnung in Ordnung und glaubte, dass das Zweite sicherlich besser sei als das Erste. Es ist heute unmöglich, und es war seit der Antike unmöglich, dass derjenige, der das höchste Gut ist, etwas hervorbringt, das nicht das Schönste wäre; Unterdessen zeigte ihm das Nachdenken, dass von allen Dingen, die ihrer Natur nach sichtbar sind, keine einzige Schöpfung ohne Intelligenz schöner sein kann als eine, die mit Intelligenz ausgestattet ist, wenn wir beide als Ganzes vergleichen; und der Geist kann in nichts anderem als der Seele wohnen. Von dieser Überlegung geleitet, ordnete er den Geist in der Seele und die Seele im Körper und baute so das Universum auf, mit der Absicht, eine Schöpfung zu erschaffen, die von Natur aus die schönste und beste war. Nach plausiblen Überlegungen sollte also anerkannt werden, dass unser Kosmos ein Lebewesen ist, das mit Seele und Geist ausgestattet ist und tatsächlich mit Hilfe der göttlichen Vorsehung geboren wurde.“
Das politische System im Verständnis Platons
Am bedeutendsten war für uns Platons Werk über das politische System. Nach seiner Theorie entsteht der Staat, weil der Mensch als Individuum die Befriedigung seiner Grundbedürfnisse nicht gewährleisten kann.
Mehrere Werke widmen sich gesellschaftspolitischen Themen Plato:
Abhandlung "Zustand"
Dialoge „Gesetze“, „Politiker“ .
Geschrieben als Dialog zwischen Sokrates und andere Philosophen. Darin spricht er über das Modell "Ideal" , der beste Staat. Ein Modell ist keine Beschreibung einer bestehenden Struktur oder eines Systems. Im Gegenteil, das Modell eines solchen Staates, den es nirgendwo gegeben hat, der aber entstehen muss, d. h. Plato spricht über die Idee des Staates, kreiert ein Projekt, eine Utopie.
Was meinte er damit "Ideal" Staat und was als negativer Zustandstyp eingestuft wurde. Der Hauptgrund für den Verfall der Gesellschaft und gleichzeitig des Staatssystems ist „Vorherrschaft egoistischer Interessen“ die Handlungen und das Verhalten von Menschen bestimmen. In Übereinstimmung mit diesem Hauptnachteil teilt Platon alle existierenden Zustände in der Reihenfolge ihrer Zunahme und Zunahme in vier Sorten ein „egoistische Interessen“ in ihrem System.
1. Timokratie - die Macht ehrgeiziger Menschen, laut Plato, behielt immer noch ihre Gesichtszüge "perfekt" Gebäude. In einem solchen Staat waren Herrscher und Krieger von landwirtschaftlicher und handwerklicher Arbeit befreit. Sportübungen werden viel Aufmerksamkeit geschenkt, aber der Wunsch nach Bereicherung ist bereits spürbar, und „unter Beteiligung von Frauen“ wird der spartanische Lebensstil zu einem luxuriösen, der den Übergang zur Oligarchie bestimmt.
2. Oligarchie. In einem oligarchischen Staat gibt es bereits eine klare Spaltung in die Reichen (herrschende Klasse) und die Armen, die der herrschenden Klasse ein völlig unbeschwertes Leben ermöglichen. Entwicklung der Oligarchie, so die Theorie Plato, führt zu seiner Degeneration zur Demokratie.
3. Demokratie. Das demokratische System verstärkt die Uneinigkeit zwischen den armen und reichen Klassen der Gesellschaft weiter, es kommt zu Aufständen, Blutvergießen und Machtkämpfen, die zur Entstehung des schlimmsten Staatssystems führen können – der Tyrannei.
4. Tyrannei. Nach der Meinung Plato, Wird eine bestimmte Aktion zu stark ausgeführt, führt dies zum gegenteiligen Ergebnis. So ist es hier: Ein Übermaß an Freiheit in einer Demokratie führt zur Entstehung eines Staates, der überhaupt keine Freiheit hat und der Laune einer Person folgt – eines Tyrannen.
Negative Formen staatlicher Macht Plato widersetzt sich seiner Vision "Ideal" Sozialstruktur. Der Autor legt großen Wert darauf, den Platz der herrschenden Klasse im Staat zu bestimmen. Seiner Meinung nach sollten die Herrscher eines „idealen“ Staates ausschließlich Philosophen sein, damit im Staat Besonnenheit und Vernunft herrschten. Es sind Philosophen, die über das Wohl und die Gerechtigkeit des Staates entscheiden Plato, weil sie charakterisiert sind „... Wahrhaftigkeit, eine entschiedene Ablehnung jeder Lüge, Hass darauf und Liebe zur Wahrheit.“ Plato glaubt, dass sich jede Innovation im Idealzustand unweigerlich verschlechtern wird es (kann „ideal“ nicht verbessern). Es ist offensichtlich, dass es die Philosophen sind, die schützen werden "Ideal" System, Gesetze aus allen Arten von Innovationen, weil sie es haben „...alle Qualitäten sowohl der Herrscher als auch der Hüter eines idealen Staates.“ Deshalb bestimmen die Aktivitäten der Philosophen die Existenz eines „idealen“ Staates und seine Unveränderlichkeit. Im Wesentlichen schützen Philosophen andere Menschen vor Lastern, was jede Neuerung im Staat darstellt Plato. Nicht weniger wichtig ist der Dank an Philosophen, Regierung und alles Leben "Ideal" Der Staat wird nach den Gesetzen der Vernunft und Weisheit aufgebaut; es wird keinen Platz für Impulse der Seele und der Gefühle geben.
Das Grundgesetz besagt, dass jedes Mitglied der Gesellschaft verpflichtet ist, nur die Arbeit zu verrichten, für die es geeignet ist. Alle Bewohner "Ideal" Der Autor unterteilt Staaten in drei Klassen:
Untere Schicht - vereint Menschen, die für den Staat notwendige Dinge produzieren oder dazu beitragen; Es umfasst eine Vielzahl von Menschen, die mit Handwerk, Landwirtschaft, Markttransaktionen, Geld, Handel und Wiederverkauf verbunden sind – das sind Bauern, Handwerker und Kaufleute. Auch innerhalb dieser Unterschicht herrscht eine klare Arbeitsteilung: Ein Schmied kann keinen Handel betreiben und ein Kaufmann kann nicht nach Lust und Laune Bauer werden.
Zweite Und dritte Klasse - Die Klassen der Krieger-Wächter und Herrscher-Philosophen werden nicht mehr durch berufliche, sondern durch moralische Kriterien bestimmt. Platon stellt die moralischen Qualitäten dieser Menschen viel höher als die moralischen Qualitäten der ersten Klasse.
Aus all dem können wir das schließen Plato schafft ein totalitäres System der Einteilung von Menschen in Kategorien, das durch die Möglichkeit des Wechsels von Klasse zu Klasse leicht gemildert wird (dies wird durch langfristige Bildung und Selbstverbesserung erreicht). Dieser Übergang erfolgt unter der Führung der Herrscher.
Es ist charakteristisch, dass selbst wenn unter den Herrschern eine Person erscheint, die besser für die Unterschicht geeignet ist, dies der Fall sein muss „Downgrade“ Daher glaubt Platon, dass sich jeder Mensch zum Wohle des Staates an der Arbeit beteiligen sollte, für die er am besten geeignet ist. Wenn sich ein Mensch nicht um seine eigenen Angelegenheiten kümmert, sondern um seine eigene Klasse, dann ist das für den „idealen“ Staat noch nicht katastrophal. Wenn eine Person unverdient vom Schuhmacher (erste Klasse) zum Krieger (zweite Klasse) wird oder ein Krieger unverdient zum Herrscher (dritte Klasse) wird, dann droht der Zusammenbruch des gesamten Staates, daher wird ein solcher „Sprung“ als der angesehen „höchstes Verbrechen“ gegen das System, denn zum Wohle des Gesamtstaates sollte ein Mensch nur die Arbeit verrichten, für die er am besten geeignet ist.
Er glaubt auch, dass drei der vier Grundtugenden den drei Hauptklassen entsprechen:
Weisheit Tugend der Herrscher und Philosophen
Mut Tugend der Krieger
Mäßigung - Menschen.
Vierte Gerechtigkeit gilt nicht für einzelne Klassen, ist es aber „überdurchschnittlich“, manche "souverän" Tugend.
I frage mich, was Plato, der zur Zeit des allgemeinen Sklavensystems lebte, schenkt Sklaven keine besondere Aufmerksamkeit. Alle Produktionsangelegenheiten werden Handwerkern und Landwirten anvertraut. Genau hier Plato schreibt, dass Sklaverei nur sein kann „Barbaren“, nicht Hellenen , während des Krieges. Allerdings sagt er auch, dass Krieg ein Übel ist, das in bösartigen Staaten entsteht.“ zur Bereicherung“ und in "Ideal" Kriege sollten im Staat vermieden werden, deshalb wird es keine Sklaven geben. Seiner Meinung nach sollten die höchsten Ränge (Kasten) kein Privateigentum besitzen, um die Einheit zu wahren. Allerdings im Dialog "Gesetze", wo auch Regierungsprobleme diskutiert werden, Plato verlagert die wichtigsten wirtschaftlichen Anliegen auf Sklaven und Ausländer, verurteilt aber Krieger. Philosophen regieren auf der Grundlage ihrer Vernunft die anderen Klassen und schränken ihre Freiheit ein, und Krieger spielen eine Rolle „Hunde“ den Untergebenen im Gehorsam halten "Herde". Dies verschärft die ohnehin schon grausame Einteilung in Kategorien.
Zum Beispiel:
Krieger leben nicht an den gleichen Orten wie Handwerker und Werktätige. Menschen „minderwertig“ Es gibt Rassen, die dafür sorgen "höher" Alles, was du brauchst. "Höher" sie beschützen und leiten „minderwertig“ die Schwächsten zerstören und das Leben der anderen regulieren.
Platon betrachtet die Einheit der Menschen als Grundlage seines Staates. In alten Zeiten, "goldenes Zeitalter" Als die Götter selbst die Menschen regierten, wurden die Menschen nicht wie heute aus Menschen geboren, sondern aus der Erde selbst. Die Menschen brauchten keine materiellen Güter und widmeten viel Zeit der Philosophie. In vielerlei Hinsicht wurde die Einheit der Alten durch die Abwesenheit von Eltern bestimmt (Jeder hat eine Mutter – die Erde). Plato möchte das gleiche Ergebnis erzielen, „sozialisieren“ nicht nur menschliches Eigentum, sondern auch Ehefrauen und Kinder. In der Theorie Plato, Männer und Frauen sollten nicht aus eigenem Antrieb heiraten. Es stellt sich heraus, Hochzeit Philosophen regieren heimlich, kopulieren das Beste mit dem Besten und das Schlechteste mit dem Schlimmsten . Nach der Geburt werden die Kinder ausgewählt und nach einiger Zeit ihren Müttern übergeben, und niemand weiß, wessen Kind er bekommen hat, und alle Männer (innerhalb der Kaste) gelten als Väter aller Kinder, und alle Frauen sind die gemeinsamen Ehefrauen aller Männer .
Der Prototyp der Macht Plato- Das ist ein Hirte, der die Herde hütet. Wenn wir auf diesen Vergleich zurückgreifen, dann in "Ideal" In einem Staat sind Hirten Herrscher, Krieger sind Wachhunde. Um eine Schafherde in Ordnung zu halten, müssen Hirten und Hunde in ihrem Handeln vereint sein, was der Autor anstrebt.
Aus der Perspektive Ihres Idealzustandes Plato klassifiziert bestehende Zustandsformen in zwei große Gruppen:
- 1. Akzeptable Regierungsformen
- 2. Regressiv – dekadent.
Den ersten Platz in der Gruppe der akzeptablen Regierungsformen belegt er "Ideal" Zustand. Er führte die dekadenten, absteigenden Staatsformen zurück Timokratie. Im antiken Griechenland gehörte Sparta des 5. und 6. Jahrhunderts am meisten zu diesem Typus. Deutlich niedriger Timokratie stand Oligarchie - die Macht mehrerer Einzelpersonen, basierend auf Handel, Wucher . Das Hauptthema der Irritation. Plato ist Demokratie, in der er die Macht der Masse, den unedlen Demos und die Tyrannei sieht, die im antiken Griechenland ab dem 6. Jahrhundert herrschte. Chr e. stellte eine gegen die Aristokratie gerichtete Diktatur dar.
Kunst im Sinne Platons
Plato betrachtet Kunst lediglich als Nachahmung der materiellen Welt, also als unechte Existenz. Und da er die Sinneswelt als einen Anschein von Ideen betrachtet, ist Kunst für ihn nur eine Nachahmung der Nachahmung . Diese verächtliche Haltung gegenüber der Kunst ergibt sich aus den Grundprinzipien seines Systems des objektiven Idealismus. Eine gewisse Rolle spielt dabei die Tatsache, dass die Blütezeit der antiken griechischen Kunst mit der Blütezeit der Sklavendemokratie zusammenfällt, die Plato gehasst. Der Philosoph erkannte die Kraft der Kunst und ließ ihre Existenz in einem idealen Zustand zu. Aber es muss der Religion dienen und die Macht des Staates stärken. Platon bringt eine Reihe von Gedanken vor (die Idee der Schönheit, des Schönen, die gesellschaftliche Funktion der Kunst usw.), die zur Weiterentwicklung der Kunsttheorie beitrugen.
Es wird oft geschrieben und gesagt, dass die Essenz der alten Kunstlehre die Nachahmung sei. Das Gleiche wird oft über Platon gesagt. Tatsächlich spielt das Prinzip der Nachahmung in der gesamten antiken Ästhetik eine sehr wichtige Rolle. Dennoch ist diese Frage sowohl in historisch-ästhetischer als auch in philologischer Hinsicht äußerst schwierig, durch verschiedene Inkonsistenzen und Vorbehalte kompliziert und erfordert eine subtile und systematische Semantik der entsprechenden Terminologie. Platon ist in dieser Hinsicht besonders komplex: Aufgrund seiner gewohnt dialogischen Darstellungsweise ist er sogar viel komplexer als Aristoteles. Die Literatur zu Platons Nachahmungslehre ist voll von unterschiedlichen Einschätzungen von Platons Nachahmung, einer ungleichmäßigen Verwendung verwandter platonischer Texte und allerlei voreiligen Schlussfolgerungen. Daher erscheint es uns angemessener, zunächst Platons tatsächliche Verwendung der relevanten Terminologie zu untersuchen, unabhängig von etwaigen Widersprüchen, die manchmal ins Auge fallen, und erst dann bestimmte allgemeine Schlussfolgerungen zu ziehen.
1. Terminologie
Der platonische Hauptbegriff hier ist Mimèsis, was wörtlich „Nachahmung“ bedeutet. Platon hat auch ein anderes Substantiv mit derselben Wurzel – mimëma, was ebenfalls „Nachahmung“ bedeutet, aber nur nicht den Prozess der Nachahmung betont, sondern vielmehr ihr Ergebnis oder ihre mehr oder weniger stabile Konsequenz; Das Substantiv mimëtës bedeutet „Nachahmer“ und das Adjektiv mimëticos bedeutet „nachahmend“. Schließlich verwendet Platon häufig auch das Verb mimoymai, „ich ahme nach“. Wörterbücher rechnen meist damit, dass jedem Menschen sofort klar ist, wie diese „Nachahmung“ zu verstehen ist. Tatsächlich verwendet Platon (wenn auch sehr selten) diese Terminologie im gewöhnlichsten, sozusagen spießbürgerlichen Sinne des Wortes. Die überwiegende Mehrheit von Platons Texten ist so beschaffen, dass man tief über die Bedeutung der hier gepredigten Nachahmung nachdenken muss, so dass es manchmal notwendig wäre, die wörtliche Übersetzung dieses Begriffs als „Nachahmung“ sogar beiseite zu lassen – nur in diesen Fällen Der Tradition halber sprechen wir von „Nachahmung“.
2. Subjektivistisches Konzept
Der allgemeinste Text über Nachahmung Platon hat zweifellos das Buch III der Republik. Hier geht es jedoch in erster Linie um Poesie und nicht um Kunst im Allgemeinen. Aber für die Nachahmungstheorie ist dieses gesamte dritte Buch der Republik von grundlegender Bedeutung.
Gleich zu Beginn dieses Buches spricht Platon ausführlich über die Unzulässigkeit solcher Themen für Dichter, die die guten Geister der Bürger eines idealen Staates zerstören und sie dazu zwingen würden, sich auf die gleiche unwürdige Weise zu verhalten, wie sich Homers Helden mit ihrer Konstante verhalten maßlose Erlebnisse, mit ihren Tränen und Schreien oder übermäßigem Lachen. Aber bereits im Text zu Beginn (388 S.) lesen wir, dass die Dichter es nicht tun sollten imitieren Wenn sie in ihrem unwürdigen Verhalten verschiedene Götter begehen, dann sollten sie umso mehr nicht den größten der Götter, Zeus, nachahmen, der auch bei Homer auf die unwürdigste Weise stöhnt. Dies bedeutet, dass es klar ist, dass Platon bei seiner Darstellung unwürdiger Subjekte bei Homer genau seine Theorie der Nachahmung im Sinn hat, obwohl er vor diesem Text den Begriff „Nachahmung“ nicht verwendet hat. Nachahmung wird hier als Fläche interpretiert subjektive und darüber hinaus unwürdige Erfindungen, nichts mit der objektiven Existenz zu tun haben, die sich nach Platon zumindest unter den Göttern durch Adel und Würde auszeichnen sollte, um nicht in rein menschliche Schwächen zu verfallen und die Selbstbeherrschung und Mäßigung nicht zu verlieren.
Als nächstes folgt Platon (392 d – 394 d) einer großen Diskussion über die Unterteilung jeder Erzählung in „einfach“ und „nachahmend“. Es stellt sich heraus, dass der Dichter nur aus sich selbst erzählen kann, indem er seine Gefühle und Gedanken in der direktesten Form ausdrückt; und er kann andererseits bestimmte Charaktere darstellen, die nicht mehr im Namen des Dichters, sondern in ihrem eigenen Namen sprechen. Mit anderen Worten, alle dramatische Poesie, das heißt alle Tragödien und Komödien und teilweise sogar Epen, ist die Sphäre der Nachahmung, aber Platon lehnt eine solche Nachahmung auf jede erdenkliche Weise als unwürdig ab, weder des Dichters noch seiner Zuhörer oder Zuschauer, die sie anerkennen unnachahmliche Art künstlerischer Kreativität. Bei der Nachahmung von Charakteren „imitiert“ der Dichter laut Platon jeden Charakter, den er darstellt, und Platon findet hier das Wesen aller Nachahmung nur in dieser Fälschung (393 S.). Sich nicht hinter dem Bild der Figuren verstecken, sondern man selbst sein – das bedeutet für den Dichter, über alle Methoden der Nachahmung hinauszugehen, einfach das Prinzip der Nachahmung selbst auszuschließen (393 d). Platon gibt sogar ein Beispiel dafür, wie Homer seine nachahmende Methode hätte vermeiden und eine einfache Geschichte von sich selbst erzählen können. Hier bietet Platon in Prosaform eine Darstellung des Beginns der Ilias, allerdings ohne die eigenen Reden der hier sprechenden Helden bei Homer (392 e – 394 b). Als Beispiel dafür, wie der Dichter aus sich selbst spricht, nennt Platon einen Dithyrambus (394 S.).
Die Frage vertieft sich und wird noch akuter, wenn sich herausstellt, dass Nachahmung nach Platon nicht nur aus dem künstlerischen Bereich, sondern aus dem Leben überhaupt ausgeschlossen ist (394 e – 396 b). Unter keinen Umständen dürfen die Hüter des Staates irgendetwas nachahmen. Jeder Nachahmer imitiert nicht nur eine Sache, sondern viele Dinge, die sich widersprechen. menschliche Natur. Hüter des Staates müssen „die sorgfältigsten Künstler der öffentlichen Freiheit“ sein (395 S.); und alle anderen Künste sowie die damit verbundenen Formen der Nachahmung sind für die Hüter des Staates sicherlich ausgeschlossen und verboten. Wenn letzterer irgendetwas nachahmen kann, dann nur erhabener und zurückhaltender Adel, der die Nachahmung jeglicher Wut, Feigheit, hemmungsloser Frauen oder Sklaven, Handwerker sowie „das Wiehern der Pferde, das Brüllen der Stiere, das Rauschen der Flüsse, das Brüllen“ vermeidet der Meere, des Donners und dergleichen“ (396 b).
Und um wieder auf die Poesie zurückzukommen, greift Platon mit neuer Kraft Nachahmer von allem Zufälligen, Unmoralischen, Bösartigen an (396 c – 398 b) und fordert, dass der Nachahmer, der selbst ein freundlicher und ehrlicher Mensch ist, gemäßigt und frei von der fließenden Vielfalt des Lebens ist , in dieser Form stellte er die gesamte Realität dar, da die Darstellung des Bösen uns an diese Schlechtigkeit gewöhnt und erfordert, dass wir in der Lage sind, allem Schmerzhaften oder Ungewöhnlichen zu widerstehen und nicht zu Sklaven aller niedrigen und bunten Aspekte des Lebens zu werden . Es ist notwendig, in die ideale Stadt nur einen „unvermischten“ Nachahmer (397 d) aufzunehmen, d. ohne der fließenden Willkür des Lebens zu erliegen (397 b). Hier ist der berühmte Text von Platon, dass der weise Dichter in seinen vielen verschiedenen Nachahmungen gedankt, mit Schafwolle gekrönt und in einen anderen Staat geschickt werden sollte und sich stattdessen an einen Dichter wenden sollte, „der strenger und nicht so angenehm ist, der die Rede von ihm nachahmen wird“. ein ehrlicher Mann“ (398 ab).
Diese ungewöhnliche Lehre Platons über die Nachahmung wird von Platon-Gelehrten nicht immer vollständig verstanden. Nachahmung ist hier nach Platon etwas maximal Subjektives und von der objektiven Realität losgelöstes, und wenn es damit verbunden ist, dann nur durch zufällige, kapriziöse Fäden, die keine Aufmerksamkeit verdienen. Bisschen von. Nachahmung ist auch mit einem echten moralischen Verfall verbunden, der einem Menschen alles Schlechte im Leben einbringt, ihn daran hindert, sich auf sich selbst zu konzentrieren, sich zurückzuhalten und im Allgemeinen er selbst zu sein. Nachahmung ist unrealistisch, kapriziös, wirr, chaotisch und darüber hinaus auch unmoralisch, niederträchtig, verdorben. Zwar erkennt man eine bestimmte Art künstlerischer Kreativität an der völligen Abwesenheit jeglicher Nachahmung. Diese unnachahmliche Kunst ist formal ein direktes Ausgießen der Seele des Künstlers ohne den Einsatz jeglicher Bildlichkeit, und in ihrem Inhalt steht sie immer auf einer großen moralischen Höhe und führt statt fließender Vielfalt in den Menschen eine innere Einheit ein, immer zurückhaltend und immer unerschütterlich.
Man kann nicht sagen, dass dieses Konzept Platons völlig klar ist. Wenn Nachahmung völlig subjektiv ist und darin nur zufällig Merkmale der Reflexion der objektiven Realität aufflackern können, stellt sich zunächst die Frage: Was ist der eigentliche Unterschied zwischen nachahmender und nicht nachahmender Kunst? Schließlich lässt Platon selbst die Möglichkeit der Durchdringung objektiv gerichteter Elemente in die Nachahmung zu. Ist unnachahmliche Kunst außerdem zwangsläufig frei von jeglicher Bildsprache, die, wie es scheint, auch auf die eine oder andere Weise die objektive Realität widerspiegeln kann? Platon glaubt überraschenderweise, dass, wenn beispielsweise Homer Achilles darstellt, dieser homerische Achilles keine Beziehung mehr zum echten Achilles hat, nichts von seinen inneren Stimmungen ausdrückt und sich nicht nur von diesem, sondern auch von anderen Heldentaten getrennt erweist Bilder von Homer, die Homer nur unehrlich nachahmt und sorgfältig verbirgt, was er selbst über alle seine Helden denkt. Und unterscheidet sich Homers Erzählung wirklich so stark von der Prosadarstellung der Ilias, die Platon anstelle von Homer anbietet?! Es scheint, dass es aus der Sicht der Nachahmungstheorie kaum einen Unterschied zwischen einem solchen Text, in dem der dargestellte Held in seinem eigenen Namen spricht und handelt, und einem solchen poetischen Text gibt, in dem die Helden selbst reden fehlen, und der Dichter drückt alle Reden und Handlungen der Helden in seinem eigenen Namen aus. Diese und andere Zweifel und Missverständnisse zwangen Platon, mehrmals auf seine Nachahmungstheorie zurückzukommen, ihre Hauptthese zu klären und verschiedene Ergänzungen vorzunehmen.
Kratylos und Sophist sprechen über die logische Struktur dieser Nachahmung, die Platon stürzte. Und über die logische Struktur richtig verstandener Nachahmung lesen wir in Buch X von „Staaten“. Bleiben wir zunächst bei diesen Dialogen.
3. Objektivistisches Konzept
A) Das in Kratylos dargelegte Grundkonzept der Nachahmung kann sehr kurz ausgedrückt werden. Zunächst einmal ist hier ausschließlich an Nachahmung gedacht physisch,- wie zum Beispiel, wenn wir unsere Hände heben, um auf die Spitze zu zeigen. Gleiches gilt für Namen, obwohl ein Name laut Platon keineswegs auf physischen Klang und die Nachahmung einiger benannter Dinge beschränkt ist (423 ab). Dies wäre eine bedeutungslose Lautmalerei oder eine Klangbewegung im Allgemeinen, so wie in der Malerei die Nachahmung von irgendetwas mit Hilfe von Farben an sich absolut nichts über den Gegenstand aussagt, den der Maler nachahmt. Wie ein Hahn zu krähen oder wie ein Schaf zu meckern bedeutet nicht, dass man sich die Namen von Hähnen oder Schafen ausdenkt (423 cd). Platons Hauptlehre läuft darauf hinaus, dass, wenn Namen als Nachahmungen betrachtet werden können, es sich hierbei nicht um Nachahmungen der physischen Aspekte von Dingen und Objekten handelt, sondern um deren Wesen(423 e - oysia), und daher waren die ersten Namen der Dinge die Götter selbst (423 e - 425 e). Hier erscheint bei Platon jene sehr klare Kategorie des Wesens, die im dritten Buch der Republik fast nicht vertreten ist.
Die Kategorie der Essenz umfasst laut Platon leere physische Geräusche, richtet sie auf bestimmte Objekte, und die Geräusche werden wirklich nicht nur zu einem Zittern der Luft, sondern zu einem bedeutungsvollen Namen für Objekte. Dies unterstreicht nur die Subjektivität der Nachahmungstheorie im Dritten Buch der Republik, obwohl die objektive Ausrichtung der Nachahmung hier noch zulässig war. Nach Kratylos wird völlig klar, dass es bei Platon keine Nachahmung in reiner Form gibt absolut keine Akte des Verstehens, und damit die Nachahmung einen objektivierenden und wirklich darstellenden Akt einschließt, das heißt, sich auf einen Gegenstand zu beziehen, ihn auszudrücken und zu reflektieren – ihn nachzuahmen – dazu ist ein objektiv sinnvolles Wesen der Gegenstände selbst notwendig, ohne das es Im Allgemeinen wird nicht bekannt, wozu Nachahmung genau dient, d. h. was genau nachgeahmt wird. Mit anderen Worten, wenn Wesen werden überhaupt nicht berücksichtigt, Nachahmung hört auf, Nachahmung zu sein und verwandelt sich in einen vagen mentalen Prozess, völlig willkürlich, bedeutungslos und nirgendwo hin gerichtet. Dies bringt zweifellos Klarheit in das Konzept von Buch III der Republik; und dadurch wird Platons Angriff auf die Nachahmung in der Republik viel verständlicher.
B) Die Frage der Nachahmung wird in The Sophist etwas umfassender, wenn auch nicht ohne Kontroversen, aufgeworfen. Wie wir oben gesehen haben (S. 22), unterteilt Platon hier alle Künste in figurative und erwerbsmäßige Künste. Zugleich gründet Platon die bildenden Künste auf der Nachahmung, sodass Bildschöpfung und Nachahmung mit ihm identifiziert werden. In diesem Fall hat die Nachahmung also im Gegensatz zu Kratylos einen gewissen objektiv darstellenden und objektiv gerichteten Charakter. Allerdings – und das haben wir auch bei der Darstellung von Kratylos (S. 36) festgestellt – vertritt Platon keineswegs diese objektivistische Position.
Er unterteilt die figurative Kunst in „Der Sophist“ (oben, S. 25) in Gleichnis und Phantastisches, Imaginäres, wobei er Ähnlichkeit auch als Nachahmung bezeichnet, jedoch im Sinne einer wörtlichen Reproduktion von Dimensionen (gemeint ist Malerei). Hier wird eine unerwartete Nuance eingeführt, nämlich dass die Nachahmung eines räumlichen Objekts, wie sich herausstellt, keine Perspektive enthalten kann, da die Perspektive unsere subjektive Darstellung ist und keiner Dimension eines objektiven Objekts entspricht. Die Aussicht sei daher nach Einschätzung des Sophisten „fantastisch“, aber nicht „assimilativ“. Letztlich ist das natürlich eine rein terminologische Frage; und wenn Platon durch die Nachahmung räumlicher Objekte wirklich die Perspektivlosigkeit in der Malerei verstehen würde, dann würden wir uns an Plagons Lehre in einer so einfachen Form erinnern. Es stellt sich jedoch heraus, dass es im Sophisten eine andere Definition von Nachahmung gibt, oder besser gesagt eine dritte – da einerseits jede figurative Kreativität bereits zur Nachahmung erklärt wurde und sich dann herausstellte, dass nur solche Kunstwerke frei von Nachahmung sind Perspektive sollte Nachahmung genannt werden. Die dritte Konnotation des Nachahmungsbegriffs im Sophisten läuft darauf hinaus (oben, S. 25), dass die Nachahmung nicht nur auf der fehlenden Perspektive beruht, sondern auch auf der Tatsache, dass dem Künstler jegliches Wissen darüber entzogen wird Motiv, das er ohne Perspektive zeichnet. Dieses Schwanken in den Tiefen der reinen Subjektivität, ohne jegliches Streben nach einem objektiven Objekt, ist offenbar völlig identisch mit der Nachahmung, von der bei Kratylos die Rede ist. Leider gibt Platon im Sophisten zu dieser Frage keine Erklärungen, warum die genannten drei Nachahmungskonzepte im Sophisten lediglich als schlecht durchdachte Widersprüche wahrgenommen werden. Da jedoch im Buch III der Republik und bei Kratylos noch eine Lücke für das objektivistische Verständnis der Nachahmung blieb, lässt Platon hier im Sophisten neben dem reinen Subjektivismus und Relativismus auch die Möglichkeit der Nachahmung als a offen Darstellung der realen Wirklichkeit, jedoch versteht man unter einer solchen Darstellung nur eine wörtliche Wiedergabe.
Im Allgemeinen führen sowohl Cratylus als auch Sophist eine bedeutende Klarstellung des Konzepts von Buch III der Republik ein. „Kratylus“ unterscheidet die Nachahmung von einem subjektiv-relativen mentalen Prozess, indem er die Möglichkeit der Nachahmung idealer Wesenheiten anerkennt, von der in Buch III nichts gehört wurde. Im Sophismus erkennt die Nachahmung neben subjektiv-relativen Akten auch solche Bilder an, die schöpferischer Natur sind und der objektiven Realität, vor allem in ihrem wörtlichen Inhalt, entsprechen können. Schließlich ist das Konzept dieser beiden Dialoge sicherlich weiter gefasst als das Konzept von Buch III der Republik. Damit beantworten wir den Zweifel, der oben im Zusammenhang mit Buch III der Republik geäußert wurde, nämlich mit der Frage Wie Laut Platon unterscheidet sich nachahmende Kunst von nicht nachahmender Kunst. Nun können wir sagen, dass es sich entweder durch die gewisse Präsenz eines Bildes darin auszeichnet, das auf die eine oder andere Weise die Realität widerspiegelt, oder durch seinen Fokus auf das Wesen von Objekten, auf ihre Bedeutung, so dass die Nachahmung von Objekten eine Nachahmung von ihnen ist Wesen, ihre Sinn. Gleichzeitig argumentiert Kratylos strenger als der Sophist, weil er direkt vom „Wesen“ spricht und nicht nur vom wörtlichen Inhalt der materiellen Realität.
4. Kritik am objektivistischen Konzept
Wenn wir uns die Argumentation des Sophisten vor Augen halten, ist auch in diesem Dialog die zulässige Objektivität der Nachahmung stark eingeschränkt. Wie wir gesehen haben, ist die Objektivität begrenzt Wörtlichkeit. Viel umfassender und tiefgreifender ist die Kritik an der Nachahmung, die im Buch X der Republik enthalten ist.
Es genügt, damit zu beginnen, dass die nachahmende Poesie hier vollständig aus dem Staat verbannt wird (595a), was wir jedoch auch im dritten Buch des „Staates“ (oben, S. 35) finden. Der Künstler (Maler) beschäftigt sich, so Platons hier geäußerte Auffassung, mit „Phänomenen“, nicht aber mit „tatsächlich existierenden Dingen“ (596 e). Hier besteht eine offensichtliche Diskrepanz zu „Cratylus“, wo der Name als Nachahmung deklariert wird Wesen. Aber im Buch X der Republik ist eine gewisse Art systematischer Konzeption gegeben. Platon predigt, dass Gott nur die Idee einer Bank erschafft, der Zimmermann eine separate Bank schafft und der Maler nur die vom Zimmermann gefertigte Bank darstellt. Somit sind der Maler, tragische Dichter und andere Künstler Nachahmer der dritten Kategorie. Gott erschafft keine separaten Bänke, nur weil alle Bänke zusammengenommen immer noch eine Art einheitliches, generisches Konzept darstellen. Und da Plata seine Ideenkonzepte substantiell denkt, ist die Erschaffung der Ahnenbank durch Gott zugleich die Erschaffung der Bank als einer idealen Sache. Danach ist es nicht verwunderlich, dass Tischler ihre eigenen, individuellen Bänke herstellen. Solange es eine generische Idealbank gibt und die Schaffung einzelner Einzeldinge in Nachahmung derselben eine einfache Sache ist (597 a–f).
Aber was schafft der Künstler dann? Da sich die Nachahmung nur auf Phänomene und nicht auf wirklich existierende Dinge bezieht, wäre ein Nachahmer von Dingen nützlicher, wenn er die Dinge selbst und nicht nur ihre Bilder erschaffen würde. Aber Homer weiß nicht, was wirklich existiert, und deshalb wurde er weder Gesetzgeber eines Staates noch Heerführer noch Pädagoge wie Pythagoras. Es ist besser, ein echter Schuhmacher zu sein, als ein Maler, der diesen Schuhmacher darstellt. Homer ist ein Nachahmer von Tugendbildern und nicht der Tugend selbst, und daher ist er darin kein Erzieher (598 a - 601 b). Der Nachahmer einer Sache weiß nicht, wie die Sache selbst hergestellt und wie sie verwendet wird. Zaumzeug und Gebiss werden von geeigneten Handwerkern hergestellt, die wissen, wie man damit umgeht. Der Nachahmer weiß nicht, wie man Dinge herstellt und wie man sie verwendet. Und deshalb „ist Nachahmung eine Art Spaß und keine ernsthafte Übung“ (602 d). „Maß, Zahl und Gewicht“ sind tatsächliche Werkzeuge, um Dinge zu erkennen und zu nutzen (602 d). Aber Maler stellen nur das dar, was ein Ding von der einen oder anderen Seite aus zu sein scheint, das heißt, sie sind völlig den subjektiven Beziehungen ausgeliefert. Sie sind alles andere als „vernünftig“ (602e). „Nachahmende Kunst ist an sich schlecht, wenn sie sich mit schlechten Dingen beschäftigt, bringt sie schlechte Dinge hervor“ (603 b).
„Unsere Seele ist überfüllt mit Tausenden ähnlicher Widersprüche, die zusammenprallen“ (603 d). „Geist und Gesetz“ widersprechen Leidenschaften, und deshalb muss sich ein Mensch im Falle eines Unglücks zurückhalten, der Vernunft und dem Gesetz gehorchen und darf nicht schreien und weinen wie Babys, die einen blauen Fleck bekommen haben und nicht wissen, was sie mit diesem blauen Fleck anfangen sollen . Je mehr Leidenschaften, desto mehr Materialien, denen man folgen kann. Aber Leidenschaften müssen bekämpft werden, daher kann Nachahmung in diesem Fall nur Schaden anrichten. Wenn ein Mensch sich einigermaßen zurückhält und Leidenschaften meidet, ist mit Nachahmung überhaupt nichts zu tun (604 f).
Nachahmer streben nur danach, der Menge und dem unvernünftigen Teil der Seele zu gefallen, und haben daher im Idealzustand keinen Platz (605 b). Nachahmung verursacht enormen moralischen Schaden. Tragische Leidenschaften und komische Possenreißer stehen in scharfem Gegensatz zu dem, was ein Mensch sein sollte, wenn er in seinem eigenen Leben Opfer einer Tragödie oder Komödie wird. Bühnenleidenschaften hindern ihn nur daran, sich in seinem eigenen Leben zurückzuhalten, und entfachen in ihm das, was seiner unwürdig ist.
Platon zieht die radikalsten Schlussfolgerungen in Bezug auf Homer und alle nachahmende Poesie im Allgemeinen, obwohl „wir selbst uns unserer Freude darüber bewusst sind“ (607 S.). Der Text über die innere Kontrolle eines Menschen über sich selbst und über seine „große Leistung“, wenn er zugunsten einer höheren Moral auf verschiedene Güter, einschließlich der Poesie, verzichtet (608 b), sollte als sehr wichtig angesehen werden.
Damit beantwortet Buch Aber diese objektive Realität wird in Buch X der Republik zu wörtlich verstanden. Zwar wird im Buch Dies erweitert das Konzept sowohl des Buches III der Republik als auch des Sophisten erheblich. Die Nachahmung wird daher von Platon im Buch X der Republik völlig bedingungslos anerkannt, aber nur hier auf die rein physische Produktion reduziert. Auf diese physische Produktion wurde sowohl im Kratylos als auch im Sophisten hingewiesen. Aber dort hat Platon sein Denken nicht so extrem und so vollkommen klar getrieben. Echte Kunst hier gibt es nach Platon einfach Produktion. Jede andere Kunst, auch wenn sie irgendein Objekt reproduziert, macht immer noch unnötigen Spaß und läuft am Ende auch auf subjektivistische Irrationalität und Laune hinaus. Schließlich wird im Buch .
Doch damit sind die Zweifel, die Buch III der Republik aufwirft, nicht erschöpft. Schließlich sprach „Kratylus“ bereits von einer Art Nachahmung Wesen. Diese Nachahmung ist höher und akzeptabler und, das muss man bedenken, sogar notwendig. Hat Platon irgendwelche Urteile über diese Art korrekter und einwandfreier Nachahmung, die nicht nur auf den „zweiten“ und „dritten“ Grad der Nachahmung, also nicht auf die handwerkliche Produktion und die subjektive Willkür der Nachahmer reduziert werden würde? .
Leider sagt Platon im Buch X der Republik nur sehr wenig über die Art der Nachahmung, die er für die grundlegendste hält und die nur Gott gehört. Wir müssen einige, zumindest einen kleinen Kommentar zu dieser höchsten Art der Nachahmung geben, wenn Gott, indem er sich selbst nachahmt, schafft Ideen für Dinge. Zunächst einmal ist der Begriff „Gott“ hier nicht ganz klar. Dass Platon hier keine antike griechische Gottheit meint, ist völlig klar. Wer hier jedoch Hinweise auf einen späteren jüdisch-christlichen Monotheismus findet, irrt sicherlich. Letzteres bedeutet eine klar definierte Gottheit mit eigenem Namen und einer eigenen detaillierten Mythologie, die üblicherweise als „heilige Geschichte“ bezeichnet wird. Man kann nur sagen, dass das religiöse Bewusstsein der Ära von Sokrates, Platon und Aristoteles die antiken griechischen – Volks-, Nationalgötter – weit hinter sich ließ. Es entstand das Bedürfnis nach einer abstrakteren Vorstellung vom Prinzip der endlos werdenden Einheit der Welt. Auf diesen Wegen entstand eine noch abstrakte, aber bereits mythologische Lehre über Gott, die sowohl vom Heidentum als auch vom Christentum völlig entfernt war. Daher wäre es ein echter Antihistorismus und einfach ein historisch-philologischer Fehler, wenn wir diesem platonischen Gott irgendwelche persönlichen Eigenschaften oder eine historische Entwicklung zuschreiben und diese Konzepte an den späteren Monotheismus anpassen würden.
Darüber hinaus ist anzumerken, dass Platons Schöpfungskonzept auch wenig mit dem späteren Kreationismus gemein hat. Gewöhnlich wird vergessen, dass die platonische Idee keinen zeitlichen und räumlichen Veränderungen unterliegt und daher weder einen zeitlichen Anfang noch ein zeitliches Ende hat. Von welcher Schöpfung erzählt uns Platon in diesem Fall? Offensichtlich überhaupt nicht in dem Sinne, dass es zunächst nichts gab und dann eine Idee zu existieren begann. Schöpfung in diesem Sinne muss einfach als wesentliche Abhängigkeit vom Schöpfer, als seine Musteridentität mit ihm verstanden werden. Mit anderen Worten: Die Entstehung einer Idee und ihre ewige Existenz sind in diesem Fall ein und dasselbe. Das dialektisches Moment der Identität der ewigen Existenz einer Idee mit ihrer Entstehung Genau das wird normalerweise übersehen, wenn man beginnt, das Konzept der Nachahmung im Buch X der Staaten zu interpretieren. Und noch eine sehr wichtige Bemerkung zu dieser platonischen Nachahmung in ihrem höchsten und tadellosesten Verständnis. Es war Platon, der über seine ewigen Ideen und ihre Geschöpflichkeit sprach, weil er bewahren wollte die völlige Individualität jeder dieser Ideen. Denn wenn eine gegebene Sache auf der Grundlage einer anderen Sache erklärt wird und diese andere Sache auf der Grundlage der Nachahmung einer dritten Sache erklärt wird usw. usw., dann beraubt diese Art der genetischen Erklärung einer Sache ihre absolute Individualität. Letzteres wird bei einem solchen Abgang in die böse Unendlichkeit in eine unendliche Reihe von Momenten geschichtet, für die jedes Mal eine spezifische Erklärung gesucht wird. Die genetische Erklärung einer Sache erklärt nach Platon (und das finden wir bei ihm mehr als einmal) 16 nicht die Individualität einer bestimmten Sache. Eine solche Individualität einer Sache ist nur aus sich selbst erklärbar, und wenn es um jeden Preis notwendig ist, über ihre Entstehung zu sprechen, dann muss sie unmittelbar, in einem Augenblick, entstehen, also von Gott geschaffen sein. Mit dieser Lehre von der Ideenschöpfung will Platon nur retten die einzigartige, unzerstörbare und irreduzible Individualität einer Sache. Dies sollte daran deutlich werden, dass selbst der Materialist Demokrit, der die absolute Individualität seiner Atome retten wollte, sie absolut fest und unempfindlich gegen äußere Einflüsse machte.
So drückt die Nachahmung, die Platon im Buch , als hätte es niemand geschaffen und als wäre es der Sphäre des Werdens völlig entzogen. Für Platon war ein solcher Nachahmungsbegriff umso einfacher und selbstverständlicher, als die gewöhnlichsten Zahlen und alle Operationen auf ihnen auch nicht von irgendwelchen Objekten abhängen und auch keinen temporären Prozessen gehorchen. Die Wahrheit, dass 2×2=4 weder Farbe noch Geruch hat, hängt nur von sich selbst ab und hat nichts mit zeitlichen Vorgängen zu tun.
5. Echte objektivistische Nachahmung in Verbindung mit anderen Arten der Nachahmung
Bereits im Buch Aber Platon hat zu diesem Thema auch andere Urteile, die eher philosophischer Natur sind. Nun müssen wir alle Fälle betrachten, in denen Platon unsere Terminologie verwendet, da das, was er richtige und wahre Nachahmung nennt, von ihm oft im Zusammenhang mit verschiedenen anderen Arten der Nachahmung gedacht wird, so dass es sich um echte, reine, wahre und unwiderlegbare Nachahmung handelt in isolierter Form kommt es darin nur äußerst selten vor; und um Missverständnisse zu vermeiden, wird es nun nützlich sein, von der Darstellung integraler Konzepte der Nachahmung zu ihrer mehr oder weniger zufälligen terminologischen Verwendung überzugehen.
Dass das eigentliche Prinzip der Nachahmung von Platon nicht völlig abgelehnt wird, ist bereits vom Sophisten bekannt. Wie wir oben gesehen haben, reduziert sich die nachahmende Kunst nach Platon keineswegs auf Sophistik, sondern umfasst auch echte Kreativität (Soph. 265 a). Hier ist auch ein weiterer Text einzubeziehen, in dem die nachahmende Poesie ebenfalls nur zu einem der möglichen Bereiche der Poesie erklärt wird (R. R. X 595 a). Nachahmende Kunst wird von Platon objektiv verstanden als die Schaffung von etwas, das vorher nicht existierte (Soph. 219 b). Nachahmung und Vergleich, argumentiert Platon (Kritias. 107 a-e), ist die Grundlage unserer Überlegungen; und je klarer die Objekte unserer Nachahmung sind, desto gründlicher können wir über sie nachdenken. Allerdings ist Platon auch hier geneigt, seine richtige Nachahmung wörtlich zu verstehen, die in der Malerei jede Perspektive des Bildes völlig ausschließt (Soph. 235e); Daher muss die Nachahmung in der Malerei dem Gegenstand der Nachahmung selbst ähnlich sein (Krat. 434 b), und die „Richtigkeit der Nachahmung“ besteht darin, den Gegenstand der Nachahmung in seiner tatsächlichen Qualität und Quantität wiederzugeben (Legg. II 668 b). Das bedeutet, dass Nachahmung sowohl gut als auch schlecht sein kann. In diesem Zusammenhang wird die sehr strenge These vertreten, dass die Malerei nicht das Vorhandene nachahmt, sondern nur das Erscheinende (R. R. X 598 a). Eine vernünftige und ruhige Gesinnung imitiert laut Platon nicht leicht etwas, sondern bleibt sie selbst und wird zum Gegenstand der Nachahmung (604 e). Im Gegensatz zu Kindern würde ein älterer Mensch lieber „die Wahrheit nachahmen“ als jemand, der nur zum Spaß scherzt und widerspricht (VII 539 c). Platon spricht direkt über die Korruption der Natur wahrer Philosophen und über jede andere Korruption, die sie nachahmt (VI 490 e). Doch obwohl Lügen in Reflexionen, in Bildern, in Nachahmungen, in Phantomen oder in den darauf basierenden Künsten zum Ausdruck kommen können (Soph. 241e), spricht Platon dennoch von musikalischen und bildlichen Bildern, die gerade durch Nachahmung lebendiger und schneller Bewegung entstehen in Dingen oder in Körpern (Politik. 306 d). Es versteht sich von selbst, dass man, um richtig mit dem Volk zu kommunizieren und es zu regieren, nicht nur sein Nachahmer sein muss, sondern dass man „natürlich“ wie es sein muss (Gorg. 513 b), und dass Platon die Frage nach Homer aufwirft: ob er nicht nur ein Künstler ist, der Bilder nachahmt, ein Nachahmer (R. R. Daher ist es keineswegs verwunderlich, dass Platon, obwohl er der Nachahmung eine gewisse Bedeutung beimisst, nach der Darstellung verschiedener Handwerksarbeiten, nach Gefäßen und Karren aller Art, die nachahmende Kunst der Malerei und Musik nur an fünfter Stelle einordnet und diese berücksichtigt Ihr einziges Ziel ist unser Vergnügen, so dass es hier überhaupt nichts außer Spaß und Scherz gibt (Politik. 288 s). Beachten wir auch, dass Dichter und alle anderen Vertreter der nachahmenden Kunst den sechsten Platz in der Reihenfolge der Seelenverkörperung einnehmen, wie wir in einem anderen Text lesen (Phaedr. 248e). Platons Einstellung zur Nachahmung ist im Allgemeinen recht widersprüchlich. Anscheinend muss man sagen, dass Nachahmung für ihn eine eher niederträchtige Angelegenheit, unnötig und manchmal sogar geradezu schädlich ist. Wie wir bereits wissen, kommt es zu dem Punkt, dass Platon eine direkte Verfälschung des Publikums der Tragödie in Betracht zieht, wenn tragische Dichter die langen Klagelieder der Helden nachahmen (R. R. X 605 S.). Aber Platon hatte ein scharfes künstlerisches Auge, um die positiven Aspekte der Nachahmung zu erkennen, egal wie selten und schwierig sie waren. Nachahmung in Worten ist laut Platon an sich keine Lüge, sondern nur eine eher vage mentale Erfahrung, die bestimmte Bilder erzeugt (R. R. II 382 b), so dass Nachahmungskunst an sich „niemanden zu einem weisen Mann machen wird“. Platon listet eine große Vielfalt an Kunsthandwerk auf (Epin. 975 d). In einer Stadt, in der Platon auch Nachahmer einbezieht, kann es viele verschiedene, völlig unnötige Spezialisten geben (R. R. II 373b); und es ist nicht verwunderlich, dass es im Bereich der Nachahmung auch imaginäre Nachahmungen, Phantome (Soph. 236 c) gibt und dass der Bereich der Nachahmung sehr umfangreich und vielfältig ist und auch Geschicklichkeit bei der Täuschung durch Worte oder Malerei umfasst ( 234 b).
Doch entscheidender Moment ist jedoch nicht die Nachahmung selbst, sondern ihre Artikel. Es soll nur Nachahmung des Schönen erfolgen, d.h. Nachahmung ist nur im Umfang ihrer pädagogischen Bedeutung zulässig (Legg. II 655 d), weshalb „man nur die Art der Musikkunst gebrauchen sollte, die aufgrund der Nachahmung des Schönen.“ , hat eine Ähnlichkeit damit“ (668 b). Die Hüter des Staates, die eine Sache und nicht viele nachahmen müssen (R. R. III 394 e), können nichts Schlechtes oder Nutzloses nachahmen (396 b). Platon mag keine „tragischen und alle anderen nachahmenden Dichter“ (R. R. X 595 b). Und doch ahmen ihn in einer idealen Staatsstruktur einige Herrscher aus hervorragenden Gründen nach, andere aus schändlichen (Politic. 297 S.). Nach der Vertreibung anspruchsvoller Dichter lässt Platon nur noch diejenigen in der Stadt zurück, die „die Reden eines ehrlichen Mannes nachahmen“ (RP III 398b); und ein ehrlicher Dichter ahmt einen guten und klugen Menschen wie ihn selbst nach, aber er wird keinen schlechten Menschen nachahmen (396 S.). Das bedeutet, dass der anspruchsvolle Modernismus nach Platon einfach gesagt eine unehrliche, das heißt perverse Nachahmung ist. Wenn also „eine Art Tanz die Rede der Muse zu edlen Zwecken nachahmt, eine andere, um dem Körper Gesundheit zu verleihen“ (Legg. VII 795 e), ist dies sowohl ehrlich als auch edel. Es ist notwendig, die Bewegung schönerer Körper „zu einem würdigen Zweck“ nachzuahmen (814 f). Die sechzigjährigen Sänger, Mitglieder des Dionysischen Chores, müssen in ihren Rhythmen und Harmonien gute Geisteszustände nachahmen (812 S.). Und im Allgemeinen wird die Nachahmung in den „Gesetzen“ offenbar als ein völlig edles Unterfangen interpretiert, vorausgesetzt natürlich, dass der eigentliche Gegenstand dieser Nachahmung edel ist, während im „Staat“ jede nachahmende Poesie generell ausgeschlossen wurde (X 598b, 603 a, c), und bei „Kratylus“ im Vordergrund kam es allgemein zur äußerlichen und lautlichen Nachahmung (423b, 427 a), und sogar der Namensgesetzgeber wurde hier manchmal als Fälscher und Kombinierer verbaler Laute interpretiert (414). B). Es stellt sich heraus, dass, obwohl „viele Streicher und Allharmonie eine Nachahmung der Flöte sind“, also schleichende und unbestimmte Klänge (R. R. III 399 d), dennoch Varianten des Tetrachords immer noch als Nachahmung des einen oder anderen interpretiert werden.“ Leben“ (400 a), und die Nachahmung selbst spielt hier noch eine gewisse Rolle, insbesondere wenn Instrumentalmusik noch nicht von Vokalmusik getrennt ist (Legg. II 669 e). Selbst eine Kunst wie der Tanz entstand nur als Nachahmung der Sprache durch Gesten (VII 816 a), ganz zu schweigen davon, dass Militärtänze im Allgemeinen reale Handlungen im Krieg nachahmen (815 a). Einerseits „ist es gut, wenn der Staat seine Feinde nicht so leicht auf schlechte Weise nachahmen kann“ (IV 705 c), andererseits wird die Solo-Nachahmungskunst (Gesang oder Instrumental) der Chorkunst gegenübergestellt, und zwar die Richter mit der Beurteilung beider Interpreten beauftragt (II 764 d). Das bedeutet, dass die Nachahmung selbst hier jedenfalls nicht geleugnet wird. Es ist legal.
Es ist auch leicht zu erkennen, dass in den Fällen, in denen Platon eine positive Einstellung zur Nachahmung hat, eine gewisse Art von Modell Verständnis für das Thema. Am verständlichsten und sogar gröbsten kommt dies in jenen Worten zum Ausdruck, in denen Platon von Reproduktionen spricht, die aus Wachs zum Zweck der Hexerei hergestellt wurden und die er „Nachahmungen“ nennt (Legg. XI 933 b). Der Vorbildcharakter der Nachahmung zeigt sich bei Platon in seiner Einteilung der Musikkunst in figurative und nachahmende Kunst (II 668 a), in seiner Lehre, dass die Musen in ihren Nachahmungen niemals heterogene Elemente zu einem Ganzen vermischen (669 d), dass man nicht zwei nachahmen könne gleichzeitig Arten der Nachahmung - Komödie und Tragödie (R. R. III 395 a), dass es unmöglich ist, die Bewegungen des Himmels zu interpretieren, ohne seine Nachahmungen vor Augen zu haben, womit Platon offensichtlich so etwas wie einen Globus meint (Tim. 40 d) .
Zweifellos hat die Nachahmung nach Platon sogar stattgefunden lehrreich Bedeutung; In Anbetracht der Tatsache, dass Kinder beispielsweise sehr anfällig für Streit sind und in Nachahmung ihrer Kritiker selbst beginnen, über alle Maßen zu kritisieren (R. R. VII 539 b), möchte Platon diese kindliche Nachahmung nutzen und empfiehlt, Kindern entsprechende kleine Spielzeuginstrumente als Nachahmung echter zu geben (Legg. I 643 S.). Beim Lernen ahmen Kinder die Helden nach, von denen sie lesen (Prot. 326 a). Es ist schwierig, in Taten und Worten nachzuahmen, was einem außerhalb der Erziehungsbedingungen begegnet (Tim. 19 f). Erziehungsberechtigte müssen eines nachahmen, und zwar von Kindheit an (R. R. III 395 S.).
Wenn wir das Prinzip formulieren wollten, durch das die chaotische, antimoralische und antikünstlerische und allgemein subjektiv-willkürliche Nachahmung bei Platon zu jener wahren und echten Nachahmung wird, die er bedingungslos anerkennt, dann ist ein solches Prinzip für ihn natürlich: Weisheit Und Wissen, also objektiv wesentliche Orientierung Nachahmung. Der springende Punkt ist, dass einige wissen, was sie nachahmen, während andere es nicht wissen (Soph. 267 b). Sie können dieses oder jenes Objekt so oft nachahmen, wie Sie möchten, ohne es überhaupt zu wissen (R. R. X 602). Es gibt Nachahmer und Scharlatane, etwa im politischen Bereich; sie kennen die Wahrheit nicht (Politik. 303 S.). Künstler können Gegenstände so oft nachahmen, wie sie wollen, nicht nur ohne sie zu kennen, sondern auch ohne den Rat derjenigen einzuholen, die sie kennen (R. R. X 601 d). Der wirklich weise König ahmt den Experten nach; und deshalb bilden diejenigen, die ihn per Gesetz nachahmen, eine Aristokratie, aber nicht per Gesetz eine Oligarchie (Politic. 301 a). Der Nachahmer kann die guten und schlechten Eigenschaften der nachgeahmten Gegenstände weder durch den Gebrauch dieser Gegenstände noch durch Menschen, die diese Gegenstände kennen, lernen (R. R. X 602 a). Dies ist ein schlechter Nachahmer, aber kein „Nachahmer des Weisen“ (Soph. 268 c). Poesie für sich genommen ist absolut nichts wert, egal wie sehr sie etwas nachahmt; und deshalb ist es notwendig, nur jene gebildeten Menschen nachzuahmen, die ohne die Hilfe von Dichtern selbstständig miteinander kommunizieren und nur „die Wahrheit erforschen“ (Prot. 348 a). Wenn bereits die Nachahmung einer menschlichen Figur die Kenntnis dieser Figur erfordert (Soph. 267 b), dann kann Platon über den Sophisten nur im ironischen Sinne sagen, dass er das nachahmt, was wirklich existiert, er also sozusagen eine Art ist des Zauberers (235 a).
Letztendlich ist echte Nachahmung nach Platon streng genommen nicht einmal Nachahmung, da es sich um die Kreativität der Dinge selbst handelt, also um deren Herstellung, und keineswegs um die Schaffung von bloßen Abbildern der Dinge. Derjenige, der sowohl den Gegenstand der Nachahmung selbst als auch sein Bild kennt, wird sich natürlich mit dem ersten befassen und nicht mit dem zweiten (R. R. 599 a). Der Schöpfer des Schönen ist so auf das Schöne selbst konzentriert, dass ihn die Frage, ob seine Nachahmung schön ist, gar nicht interessiert, obwohl er beispielsweise die Regeln der Harmonie und des Rhythmus kennen muss (Legg. II 670 e) . Und dass aus einer solchen Sicht Nachahmung streng genommen keine Nachahmung mehr ist, ist sich Platon selbst bewusst, wenn er behauptet, dass „geschicktes Handeln“ nicht mehr Nachahmung, sondern das „maximal Wahre“ nutze, so stellt sich heraus heraus, dass nur die Unwissenden Nachahmung verwenden (Politik. 300 e). Dennoch will sich Platon von diesem Begriff nicht trennen und verwendet ihn sogar gerne, aber nur in der Anwendung auf das Sein selbst, wenn einige seiner Seiten seine anderen Seiten imitieren, worum es aus unserer Sicht also nicht geht überhaupt eine Frage der Nachahmung, sondern in der realen Erzeugung einer Tatsache durch eine andere Tatsache, wenn sie einander ähnlich sind und einander entsprechen. In diesem Sinne kann ein Mensch ein echter Nachahmer sein, das heißt, wir würden sagen, er kann sich selbst und alles um ihn herum aktiv und wirklich neu gestalten.
Die klarsten Texte zu diesem Thema finden wir in Timaios. Formlose Materie wird zunächst zu Feuer, Wasser, Luft usw. aufgrund der Tatsache, dass dies alles eine Nachahmung übersinnlicher Ideen und wahrhaft existierender Dinge ist (49 a, 50 c, 51 b). Platon stellt sich hier einen rein existenziellen und darüber hinaus einen zutiefst fundamentalen Prozess vor. Andere Texte dieser Art stellen nur Gedanken zur Anwendung dieses tiefsten Prinzips dar, obwohl sich auch diese Anwendung durch große Tiefe und große Breite auszeichnet. Platon behauptet, dass sich im Zusammenhang mit der Veränderung der kosmischen Periode durch die Nachahmung des Ganzen auch alle einzelnen Dinge veränderten (Politik. 274 a). Die kreisende Bewegung imitiert einen Kreisel und ähnelt der gesamten Zirkulation des Weltgeistes (Legg. X 898 a). Der beste Idealstaat ist eine Nachahmung des Königreichs Kronos (IV 713 b). Musikalische Töne sind eine Nachahmung der göttlichen Harmonie (Tim. 80 b). Es ist notwendig, die Körperteile zu pflegen und dabei „das Bild des Universums nachzuahmen“ (88 cd).
6. Haushalts- oder nichttechnische Bedeutung.
Schließlich mangelt es Platon nicht an Texten, in denen der Begriff „Nachahmung“ überhaupt keine besondere Bedeutung hat. Wenn Platon von der Nachahmung des Odysseus in Lügen (Hipp. Mai. 370 e) oder von der „Nachahmung von mir“ (Alcib. I 108 b), von der Ehrung seines Gottes und seiner Nachahmung (Phaedr. 252 d), von der Nachahmung der Potenzantwort schreibt (Theaet. 148 d), über die Nachahmung der Bewegung eines Körpers durch Gesten (Grat. 423 b), über die Nachahmung der eigentlichen Natur einer Sache durch Anheben der Hände, um die Höhe auszudrücken (423 a), über die Klangnachahmung von Schafe, anstatt sie zu benennen (423 c), dann drückt Platon in all diesen Nachahmungen natürlich nichts Ästhetisches aus. Bei Schwangerschaft und Zeugung ist es nicht die Erde, die die Frau nachahmt, sondern die Frau die Erde (Menex. 238 a). Die Fremden, die sich winden und ihnen entgleiten, ahmen Proteus, den „ägyptischen Sophisten“, nach, aber man muss Menelaos in seiner Behandlung von Proteus nachahmen (Euthyd. 288 v. Chr.). Es ist von „der nachahmenden Menge“ oder dem nachahmenden Volk im weitesten und vagesten Sinne die Rede (Tim. 19 d). Die Timokratie imitiert teils die Aristokratie, teils die Oligarchie (R. R. III 547 d). Wir lesen von der „Nachahmung des Herrschers“ bei denen, die sich schützen und erheben wollen. Ein solcher Nachahmer wird denjenigen töten, der den Herrscher nicht nachahmt (Gorg. 511 a). Die Athener konnten nicht durch Nachahmung der Seemannschaft zu Seeleuten werden (Legg. IV 706 b). Die Astynomier sollten die Agoranomier in ihrem Anliegen um die Verbesserung der Stadt nachahmen (VI 736 b). Falsche Freuden in der menschlichen Seele imitieren auf komische Weise wahre Freuden (Phileb, 40 S.). Einen anderen in der Stimme oder im Aussehen nachzuahmen bedeutet, ihn nachzuahmen (R. R. III 393 S.). In all diesen Texten besteht keine Notwendigkeit, eine ästhetische oder insbesondere philosophisch-ästhetische Bedeutung des Begriffs zu finden.
7. Zusammenfassung unterschiedlicher Verständnisse von Nachahmung
Um unsere vorgeschlagene Betrachtung platonischer Konzepte und Begriffe aus dem Bereich der Nachahmung zusammenzufassen, müssen wir sagen, dass Platon sowohl aus ästhetischer als auch aus philologischer Sicht mindestens fünf verschiedene Beziehungen zu diesem Thema hat. Wenn wir die Chronologie von Platons Werken genau kennen würden, könnten wir vielleicht die historische Entwicklung von Platons Lehre feststellen und scharfe Widersprüche vermeiden. Da wir jedoch nicht über eine so genaue Chronologie verfügen und wir im selben platonischen Dialog eine Mischung widersprüchlicher Begriffe gefunden haben, bleibt dem Forscher nur ein Weg: die unterschiedlichen Verständnisse von Nachahmung in einer logischen und systematischen Reihenfolge zu konstruieren Platon hat es tatsächlich getan.
Erstens wird Nachahmung von Platon am häufigsten als verstanden subjektive freiwillige Handlung, so weit vom Thema der Nachahmung entfernt, dass diese als Ergebnis der Nachahmung in einer chaotischen, verwirrten und bedeutungslos chaotischen Form erscheint. Über eine solche Nachahmung lässt sich sagen, dass selbst das, was sie nachahmt, unbekannt bleibt, und eine solche Nachahmung kann sogar als völlige Abwesenheit jeglicher Nachahmung betrachtet werden. In diesem Sinne stellt Platon direkt fest, dass wahre Kunst nichts mit der Nachahmung von irgendetwas zu tun hat.
Zweitens hat Platon genügend Texte, in denen Nachahmung interpretiert wird und objektiver und wo es gerade aus diesem Grund nicht mehr völlig abgelehnt, sondern einigermaßen anerkannt wird. Hierbei handelt es sich um eine wörtliche Reproduktion physischer Objekte ohne jeglichen Respekt vor der Perspektive des Bildes, denn für Platon ist die Perspektive zu subjektiv, um dies zu berücksichtigen. Wie ist solche Kunst möglich? Darauf sollten Kunsthistoriker eine genaue Antwort geben. Aber es scheint uns, dass diese Anforderung dem sehr nahe kommt, was wir in der ägyptischen Skulptur oder in einer rein flächigen Darstellung einer Sache haben, wenn die Vorderseite der Sache und ihre Rückseite getrennt dargestellt werden, so dass man nicht über die andere urteilen kann . Es gibt hier wirklich keine skulpturale oder bildnerische Perspektive.
Drittens predigt Platon nicht nur die wörtliche Nachahmung der Dinge, sondern auch die Nachahmung ihrer semantischen, idealen, wesentlichen Seite. Dies jedoch essentiell Nachahmung setzt bereits das Vorhandensein des einen oder anderen idealen Objekts voraus, das wir mit Hilfe bestimmter physikalischer Materialien nachahmen. So stellt ein Schreiner eine Bank her, indem er die Idee einer Bank nutzt. Dies ist die Einschränkung der essentiellen oder semantischen Nachahmung. Sie ist daher auch im Kern nicht frei und setzt für sich die Anwesenheit anderer, sehr bedeutsamer und nicht mehr nachahmender Autoritäten voraus. Platon hat natürlich nichts gegen eine solche Nachahmung. Aber auch solche Nachahmungen, deren Ergebnis handwerkliche Produkte und alles Reale sind, was der Mensch im Leben schafft, spielen für Platon noch immer eine untergeordnete Rolle.
Viertens wird die gerade angedeutete Art der Nachahmung von Platon bis zur äußersten Verallgemeinerung erweitert und allgemein als Nachahmung interpretiert, die als Ergebnis einer völlig existenziellen (und nicht nur denkbaren) Wechselwirkung von bedeutungsvollen Ideen und ewig werdender und daher bedeutungsloser Materie entsteht. Für Platon verliert diese allgemeine kosmische Nachahmung bereits jeglichen Charakter der Subjektivität, Willkür und anderer Mängel bisheriger Nachahmungsarten. Hier haben wir das ästhetische Grundkonzept Platons vor uns.
Fünftens schließlich neigt Platon dazu, diese kosmische Nachahmungstheorie zu einem wahrhaft schöpferischen Akt zu verfeinern. Diese wahrhaft schöpferische Nachahmung ist jedoch nur für Gott charakteristisch, der nicht sinnliche Bilder sinnlicher Dinge und nicht die Dinge selbst in ihrer Individualität schafft, sondern äußerst Allgemeines schafft Ideen von Sachen. Diese substanziell-ideale Reproduktion seiner selbst im anderen Wesen durch Gott ist für Platon die ultimative Verallgemeinerung und zugleich die ultimative Spezifizierung der für ihn überhaupt akzeptablen Arten der Nachahmung. Hier findet Platon nur wahre Kreativität, denn weder die Anfertigung einer Bank nach ihrer gegebenen Idee, noch mehr noch die Reproduktion dieser sinnlich hergestellten und sinnlich verkörperten Idee ist eine echte und wirkliche Nachahmung, sondern nur ihr für das Leben brauchbares Abbild es ist utilitaristisch (Handwerk, Heilung, gesellschaftspolitischer Aufbau) und völlig nutzlos, unnötig und schädlich, wenn es nicht utilitaristisch ist, sondern nur die Ziele der subjektiven menschlichen Belustigung und nur des kontemplativen Nichtstuns hat.
Wie wir sehen, ist Platons Interpretation der Nachahmung recht vielfältig und widersprüchlich; und der Versuch, dem Text Platons zumindest eine gewisse philologische und ästhetische Klarheit zu verleihen, zwingt uns unweigerlich dazu, all diese schwierigen Widersprüche der Texte aufzudecken und so zu formulieren, dass uns jeder verwandte platonische Text im Grad seiner Widersprüchlichkeit und völlig klar wird im Grad seiner Annäherung an klare Konzepte.
8. Aus der Literatur zur platonischen Nachahmung
Lassen Sie uns zum Abschluss der umfangreichen Literatur zur platonischen Nachahmung über einige der wichtigsten Werke sprechen.
Der älteste von ihnen gehört V. Abeken. Abeken 17 formuliert einen traditionellen Vergleich über den Kontrast zwischen den Ansichten von Platon und Aristoteles zur Nachahmung: Für Platon bezieht sich Nachahmung auf Epos und Drama und für Aristoteles auf die gesamte Poesie im Allgemeinen. Für Platon sind Ideen außerhalb der Materie angesiedelt, während sie für Aristoteles in der Materie selbst liegen. Unsere vorherige Darstellung zeigt, dass diese ganze Problematik bei Platon viel komplexer ist und dass Abeken hier daher zu einfach argumentiert. Abeken 18 vertritt die nützliche Ansicht, dass Homer nicht wegen der schlechten Qualität seiner Poesie aus Platons Idealzustand ausgeschlossen wird, sondern weil er die Seelen weicher macht. Zur Analyse platonischer Nachahmung
Abeken stützt sich auf eine Reihe wichtiger Texte – Theaet. 152 de; R.P.X 595 c, 607 c; Phaed. 95 a; Bein. III 682 a, VI 776 e; Phileb. 62 d. Inwieweit das wissenschaftliche Verständnis der platonischen Nachahmung im vergangenen Jahrhundert fortgeschritten und vertieft wurde, lässt sich anhand der Arbeit von E. Stemplinger beurteilen19. Dieser Autor argumentiert in Anlehnung an E. Zeller, dass Platon in seinen Ansichten über das Wesen und die Rolle der Kunst zu einer früheren Position zurückgekehrt sei als die Sophisten, die den Gegensatz „Natur – Kunst“ einführten. Es ist Platon, der in diesem Problem direkt auf die dorischen Melos in Sizilien zurückgreift, und das Wort „Mimesis“ selbst wird zunächst nur von Pindar, Theognis und anderen dorischen Dichtern verwendet. Nicht umsonst lehnt Platon das Epos und das Drama ab, die sich durch die Methode der Nachahmung auszeichnen, sondern erkennt vielmehr die Lyrik an, da sie eine direkte Ausgießung der Gedanken und Gefühle eines Menschen ist, und erkennt vor allem den Dithyrambus an . Andererseits erwies sich Platon laut E. Stemplinger als näher an der alten und populären Idee, dass nur das Universum und die Natur von allem ein Kunstwerk in seiner reinen Form ist; Die Kunst der Sterblichen ist nur ein unwichtiger, blasser Abglanz des ersten kosmischen Kunstwerks 20 . E. Stemplinger vergleicht damit die Tatsache, dass das Wort „Mimesis“ weder bei Homer noch bei Hesiod vorkommt. Stemplinger spricht hauptsächlich über Mimesis in der Literatur und glaubt, dass die entsprechende Lehre Platons viele Lücken und Widersprüche aufweist. Aber die Tatsache, dass Platon den Dichtern schöpferische Kreativität verweigerte, findet eine Parallele in einer anderen Position Platons, nämlich dass selbst der Demiurg für ihn nicht die Macht der Schöpfung besitzt (R. R. VII 514 ff.). Auch Platon erkennt die schöpferische Kraft der Fantasie nicht an, obwohl er selbst deren Früchte in seinen Werken nutzt (Soph. 266 b ff.). Die Kritik, die er an Künstlern richtet (R. R. X 595 a), ist nicht ästhetischer, sondern ethischer Art: Nicht ihre Methode selbst – die Nachahmung – ist schlecht; Das Schlimme ist, dass sie sich in die sichtbare Seite einer Sache vertiefen und deren Inhalt vernachlässigen.
Traditionelle künstlerische Nachahmung vermittelt nach Platon im Verständnis von E. Stemplinger kein „Wissen“ (epistêmë). Dies ist Platons erkenntnistheoretische Argumentation in der Republik (X 595 c – 602 b). Daher interpretiert Platon alle Kunst als „repräsentativ-schöpferisch“ (eidolopoiicë). E. Stemplinger zitiert jedoch nicht die entsprechenden Passagen aus dem Sophist, wo dieser Begriff am häufigsten vorkommt (wir haben oben, S. 37). Auch die Rhetorik ist nach Platon ein „Idol“, also eine „Reflexion“ des „politischen Augenblicks“ (Gorg. 463 d). Kunst ist daher einfach ein Kinderspielzeug (R. P. X 602 b; vgl. Legg. II 656 c, Dabei
E. Stemplinger irrt, wenn er glaubt, dass Platons Künstler ohne jede Nachahmung, sondern nur auf der Grundlage rein irrationaler Inspiration die ideale Welt begreifen und darstellen könnten 21 . Wir haben oben (S. 40) bereits bewiesen, dass die absolute Irrationalität von Platon nicht klar erkannt wird. Im Allgemeinen bringt das Werk von E. Stemplinger einige wichtige Überlegungen zur platonischen Mimesis zum Ausdruck, die vorplatonischen Wurzeln dieser Mimesis werden von diesem Autor jedoch zu kurz und in zu allgemeiner Form angedeutet.
V. Verdenius 22 konnte beweisen, dass Platon in seinen Ansichten über die Kunst teilweise der modernen Ästhetik nahe stand, als er in mehreren Dialogen über folgende Aspekte der Kunst sprach: Der Künstler schafft, wenn er sich von Inspiration leiten lässt. Allerdings bringt er viel von seiner Persönlichkeit in seine Figur ein. Das Material, das der Künstler verwendet, ist trivial. Der Inhalt, den er aus diesem Material gewebt hat, ist hoch. Kunst ist „ein Traum und ein Traum“ (Soph. 266 S.). Missverstandene Kunst kann der Seele großen Schaden zufügen; daher ist es mit Vorsicht zu genießen (R. R. X. 608 a; Legg. III 669 v. Chr.).
V. Verdenius glaubt, dass Platons Nachahmungslehre eng mit dem hierarchischen Weltbild verbunden ist. Die empirische Welt stellt keine wahren Dinge dar, sie ist nur eine ungefähre Nachahmung derselben. Unsere Gedanken und Beweise sind eine Nachahmung der Wirklichkeit (Tirn. 47 v. Chr.; Kritias. 107 v. Chr.), Worte sind eine Nachahmung von Gegenständen (Krat. 423 e – 424 b), Töne sind eine Nachahmung der göttlichen Harmonie (Tim. 80 b), Die Zeit ahmt die Ewigkeit nach (38 a), Gesetze ahmen die Wahrheit nach (Politik. 300 c), menschliche Macht ist eine Nachahmung der wahren Macht (Politik. 293 a, 297 c), Gläubige versuchen, ihre Götter nachzuahmen (Phaedr. 252 c, 253 b ; Legg. IV 713 f), sichtbare Figuren – Nachbildungen ewiger Figuren (Tim. 50c) usw. Aber W. Verdenius spricht fast gleichzeitig von imitatio, Imitation und imago, dem Bild, und weist nirgendwo direkt darauf hin, dass im platonischen Kontext das Erste im Lichte des Zweiten verstanden werden kann, nämlich als „die Schaffung eines Bildes“, „Bild“. „, „Darstellung“, „Verkörperung“. Daher erklärt Verdenius die offensichtliche Absurdität, die sich aus einer unzureichenden Übersetzung ergibt (wie kann die Zeit tatsächlich die Ewigkeit „nachahmen“?), damit, dass „Nachahmung“ für Platon angeblich nur eine ungefähre und keine exakte Kopie bedeutete 23 . Die zur Stützung dieser Meinung angeführten Passagen aus Kratylos können ihren Zweck nicht erfüllen, da sie speziell vom Bild und nicht von der Mimesis sprechen (423 v. Chr.). Wenn wir jedoch einzelne Äußerungen Platons nicht bemängeln, dann muss seine Nachahmung in der Tat viel komplexer verstanden werden als nur eine wörtliche Reproduktion. Es enthält ein ziemlich intensiv zum Ausdruck gebrachtes subjektives Leben des Künstlers, die Präsenz künstlerisch verarbeiteter Bilder und die Fähigkeit, sich einem nachgeahmten Objekt auf unendlich vielfältige Weise zu nähern. All diese Merkmale der platonischen Nachahmung geben V. Verdenius die Grundlage, sie als eine grundsätzlich gesunde künstlerische Methode und daher durchaus in der Nähe aktueller künstlerischer und theoretischer Fragestellungen zu verstehen.
R. Lodge 24 betrachtet das zentrale Thema der „Mimesis“ als das Geheimnis von Platons doppelter Haltung ihr gegenüber: Einerseits enthüllt die mimetische Kunst durch die Inspiration des Künstlers den Menschen das Geheimnis der Götter, es ist notwendig in Ausbildung; andererseits wird es aus dem Idealzustand vertrieben. Gleichzeitig glaubt R. Lodge nicht, dass Platon hier einen Widerspruch hat: Die Nachahmung niedriger Dinge ist eines Bürgers wirklich unwürdig, während die Nachahmung hoher Dinge lobenswert ist. Er glaubt fälschlicherweise, dass der Begriff „Mimesis“ in epischen Gedichten verwendet wurde, beispielsweise in Homer 25, und lässt die Möglichkeit einer anderen Interpretation des Begriffs nicht zu. Die allgemeine Tendenz des Buches deutet darauf hin, dass R. Lodge die bekannten Theorien Platons hauptsächlich in freier Sprache darlegt und auf viele Texte verweist, ohne sie einer besonderen Analyse zu unterziehen.
Wie der Untertitel von G. Kollers Buch 26 zeigt, hat dieser Autor die traditionelle Übersetzung des Begriffs „Mimesis“ als „Nachahmung“ aufgegeben. G. Koller war gezwungen, eine neue Übersetzung für den Begriff der Mimesis zu geben, da Dutzende Fälle vorliegen, in denen Mimesis in einer Bedeutung vorkommt, die nicht in „Nachahmung“ passt, und auch, weil das entsprechende Verb „nachahmen“ im Griechischen mit einem Direkten verwendet wird Objekt 27 . Hier ist eines dieser Beispiele. Bei Aristophanes (Thesm. 850 ff.) blickt Mnesilochus mit seinen Augen auf Euripides, der an dieser Stelle noch nicht erschienen ist, wohl weil er sich für seinen langweiligen „Palamedes“ schämt. Mnesilochos sagt:
Zu welcher Leistung werde ich ihn zwingen, hierher zu kommen?
Ah, ich habe es mir ausgedacht
Schließlich bin ich als Frau verkleidet.
Aber Mnesilochos er spielt Elena(Art. 855) und in Art. 871 Euripides erscheint als der Schiffbrüchige Menelaos. Die Wörterbuchbedeutungen des Wortes „Mimesis“ reichen hier nicht aus; Dieser Satz bedeutet natürlich: „Ich werde die neue Helen sein.“ spielen, ihre Rolle spielen, ihr zeigen“ 28 .
Auch die Etymologie des Wortes „mimesis“ ist unklar und weist wahrscheinlich keine Parallelen in anderen indogermanischen Sprachen auf. Die Annahme, dass dieses Wort aus der Sprache der vorgriechischen Bevölkerung stammt, wird durch die Tatsache gestützt, dass es in der epischen Dichtung nicht vorkommt. In Anbetracht der Tatsache, dass alle frühen Orte, an denen dieses Wort vorkommt, mit Tanz zu tun haben (Anm. Hymn. Apoll. II 163), schlägt G. Koller vor, dass Mimoi, von denen Aischylos spricht (Strabon, X 3, 16), - dies sind Schauspieler von der dionysische orgiastische Kult. Diese Annahme beseitigt viele Schwierigkeiten auf einmal. Schließlich ist Dionysos es eigentlich nicht griechischer Gott ist ein Relikt der antiken vorgriechischen Religion. So ist Mimesis laut G. Koller ursprünglich eine Tanzaufführung, bei der Wort, Rhythmus und Harmonie vereint werden. G. Koller liefert reichlich Material zur Mimesis im Zusammenhang mit Tanz. Er erwähnt den Kriegstanz-Pyrrhus bei Platon und Xenophon (Legg. VII 796 b; Anab. VI 5), Bemerkungen zum Tanz der Phäaken bei Athenaeus (I 15 de), zum „Kranichtanz“ des Theseus bei Plutarch (Thes. 21). Plutarch bezieht sich auf Mimesis in Mysterientänzen (293 S.). Das Mysterium über die Hochzeit von Zeus und Hera in Diodorus (V 72) kann nicht als einfache Nachahmung interpretiert werden, sondern als Versuch der Mysterienteilnehmer, vorübergehend selbst zu Zeus und Hera zu werden. Strabo (X 467) sagt direkt, dass die Mysterien ihrer Natur nach „Mimesis“ waren, eine Nachahmung einer Gottheit, die der gewöhnlichen menschlichen Wahrnehmung unzugänglich war. G. Koller glaubt, dass Platons Theorie der Mimesis und Terminologie von ihm vom Musiker Damon 29 übernommen wurde, der die Lehre von den Musikstilen über das Ethos, die auch an Platon weitergegeben wurde, im Detail entwickelte.
Bei Platon bewegt sich die Mimesis jedoch von der Sphäre der Musik zur Kunst des Wortes, zur Poesie, das heißt, eine durch Klang und Geste ausgedrückte Darstellung wird zu einer Darstellung – einer Handlung 30.
All diese und andere von G. Koller zitierte Überlegungen und Texte belegen deutlich, was normalerweise nie berücksichtigt wurde, nämlich dass das künstlerische Wesen der antiken griechischen Nachahmung untrennbar mit der Tanzkunst und dem griechischen Verb verbunden ist „imitieren“ bedeutete ursprünglich „im Tanz nachahmen“. Dieser Moment zwingt uns, Platons Texte aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten und sie vom Standpunkt orchestrischer Ideen aus genauer zu betrachten. Dieser Begriff erscheint erstmals bei Platon und wie immer nebenbei auch in der Republik (III 388 S.). Als nächstes kommen die bereits bekannten Unterscheidungen zwischen nachahmender und nicht nachahmender Kunst (392 d – 394 c). Koller macht jedoch darauf aufmerksam, dass bereits hier (394 e – 395 b) die technische Einteilung in nachahmende und nicht nachahmende Künste für Platon eine rein ethische Bedeutung erhält und ausschließlich zu Bildungszwecken betrachtet wird. Koller argumentiert, dass die gesamte Passage (396 b – 397 a), wenn nicht komponiert, so doch von Damon inspiriert wurde, der als erster über das ethische Verständnis von Musik sprach. Platon übertrug diese Einteilung nicht nur von der Musik auf die Poesie, sondern griff auch die „modernistische“ Musik seiner Zeit an, sodass Nachahmung hier eine andere, nämlich völlig negative Bedeutung erhielt. Platon erlaubt die Nachahmung nur von erhabenen Gegenständen. Dieser Zustand verschärft sich im Buch X der Republik, wo die ursprüngliche Idee der Nachahmung bis zur Unkenntlichkeit verzerrt wird. Bezeichnend ist auch, dass Platon im dritten Buch von Nachahmung im Zusammenhang mit Musik spricht und diese im weiteren Sinne des Wortes als musikalische Kunst versteht, zu der zwangsläufig auch der Tanz gehört. In den „Gesetzen“ zitiert Platon im Allgemeinen auch Damons System, jedoch in voller Anerkennung der Rechtmäßigkeit der Nachahmung, das heißt, er kehrt wieder zum alten Verständnis der Nachahmung zurück.
Die Forschungen von G. Koller führen eine neue und sehr lebendige Strömung in die traditionelle Idee der platonischen Nachahmung ein. Der Leitgedanke dieser Studie rückt in der antiken Nachahmung nicht nur die Nachahmung eines fertigen und bewegungslosen Objekts in den Vordergrund, sondern auch dessen aktive Reproduktion mit den Methoden der Tanzkunst. Um den Stellenwert und die logische Bedeutung von Platons Nachahmungslehre besser zu verstehen, stellt G. Koller eine Tabelle der antiken Bedeutungen der Nachahmung zur Verfügung, die wir hier wiedergeben (siehe Tabelle) 31 .
9. Drei Koordinaten platonischer Nachahmung
Als Ergebnis des Studiums der Texte Platons und ihrer neuesten Interpretationen muss festgestellt werden, dass Platon mehrere unterschiedliche Tendenzen in der Nachahmungslehre aufweist, die sich von ihm nicht immer klar und nur manchmal klar und scharf unterscheiden. Diese Tendenzen sind die Koordinaten, die es ermöglichen, Ordnung in das bunte Bild von Platons „Mimesis“ zu bringen.
Die erste solche Koordinate kann aufgerufen werden Subjekt Objekt. Hier finden wir sowohl eine völlig subjektive Interpretation der Nachahmung als auch Merkmale ihrer objektiven Ausrichtung, die so weit geht, dass Nachahmung nicht mehr nur eine Nachahmung eines Objekts ist, sondern zu seiner echten und realen Schöpfung, sogar zu seiner Produktion – physisch, psychisch, sozial – wird und kosmisch.
Die zweite Koordinate von Platons verschiedenen Verständnissen der Nachahmung kann aufgerufen werden Werden. Es zeigt sich, dass sich Nachahmung nicht nur in unterschiedlichen Subjektivitäts- oder Objektivitätsgraden unterscheiden kann. Diese Schritte wandeln sich jedoch kontinuierlich ineinander, so dass es oft schwierig ist festzustellen, inwieweit Platon an Nachahmung interessiert ist. Bei Platon findet man sowohl Texte, die die Bedeutung der Nachahmung völlig zerstören, als auch Texte, in denen die Nachahmung für ihn eine primäre, sogar kosmische Rolle spielt.
Und schließlich hat Platon zweifellos die pangriechische Kunst und das pangriechische Leben im Sinne der Tanzkunst nachgeahmt, die als dritte Hauptkoordinate seiner Lehre gelten muss. In manchen Texten ist keine Choreografie völlig unsichtbar. Sie können es in anderen Texten erraten. In dritten Texten wird die Nachahmung direkt als echte und reale choreografische Darbietung erklärt und als so universell, dass der gesamte Idealstaat, wie sich herausstellt, nur weiß, was er singen und tanzen soll, und damit die gesamte ideale Welt verkörpert.
Bei der Beurteilung jedes platonischen Textes, der einen Hinweis auf eine Nachahmung enthält, ist es notwendig, diese semantischen Koordinaten zu berücksichtigen, die allein die hier erforderliche Genauigkeit des Verständnisses gewährleisten können. Als Ergebnis dieser drei Kräfte erfordert die Bedeutung des Wortes „Mimesis“ von uns je nach Kontext jeweils ein sehr unterschiedliches Verständnis. Dies sind „Nachahmung“ und „Reflexion“ und „Interferenz mit der Reflexion“ und „Reproduktion“ und „Kreativität“ und „Identifizierung von Subjekt und Objekt“ und dieser oder jener Aspekt von „Subjekt und Objekt“ usw . .
So könnte man dies unklar, verwirrend und dennoch sehr intensiv hervortretend formulieren Lehre von der Nachahmung.
Die Seite wurde in 0,05 Sekunden generiert!